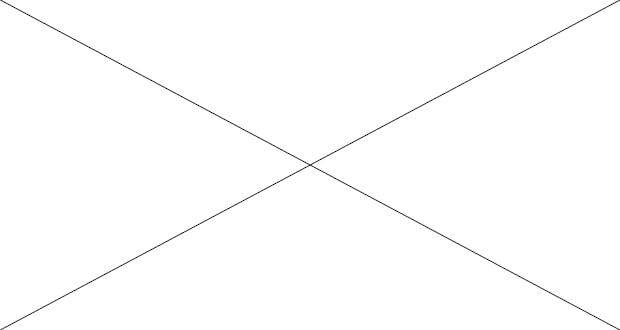Spätestens seit den Demonstrationen gegen „Stuttgart 21“ ist für die Medien klar: 2010 ist ein Protestjahr, wie es die Bundesrepublik lange nicht erlebt hat. Anti-Atom-Protest in Berlin und der Widerstand gegen den Castor-Transport im Wendland, die Initiative zum Volksentscheid für ein bayerisches Rauchverbot, der Hamburger Schulentscheid und zuletzt auch die Proteste gegen „Stuttgart 21“ – seit Jahrzehnten sollen nicht mehr so viele Menschen aus Protest gegen die Entscheidungen der Politik auf die Straße gegangen sein. Ein neues 1968 wird heraufbeschworen.
Und tatsächlich finden sich Ähnlichkeiten zwischen der Protestbewegung der späten 1960er Jahre und den heutigen Protesten. Die gezielte Regelverletzung – von Rudi Dutschke als Mittel der Selbstaufklärung über die politischen Verhältnisse propagiert – gehört zum festen Repertoire der engagiertesten Demonstranten. So wie die „68er-Bewegung“ die erste Protestbewegung war, die Fernsehen und Presse durch Ereignisinszenierungen im Medienformat für ihre Belange zu instrumentalisieren suchte, so leisten die Demonstranten auch heute gezielte Medienarbeit: vom Live-Stream der Baumbesetzung im Stuttgarter Schlossgarten bis hin zu den „Embedded Journalists“ beim Schottern der Castor-Strecke.
Benno Ohnesorgs Tod am 2. Juni 1967 schien zu verdeutlichen, wie sehr die Demonstranten der staatlichen Willkür ausgeliefert waren. Der Vorfall wurde zu einem Wendepunkt der Bewegung. Ein ähnlicher Fall 2010: Auch die Bilder des schwer an den Augen verletzten Rentners Dietrich Wagner wurden zum Symbol übertriebener Härte des Staates gegen seine Bürger. Und wie 1968 ist die „Bild“-Zeitung an vorderster Front, wenn es darum geht, die Vorkommnisse bei Demonstrationen zu skandalisieren oder gar – wie im Falle des Wendlands – den Bürgerkrieg auszurufen.
Aber 2010 ist nicht 1968. Damals wurden Politik, Polizei und Gerichte unvorbereitet von den aus amerikanischer Bürgerrechtsbewegung und ästhetischem Avantgardismus entlehnten Protestformen getroffen. Heute sind Sitzblockaden für Demonstranten wie Polizisten ein Ritual, das juristisch bis ins Detail geregelt ist. Ein Eskalations- oder Mobilisierungspotenzial wie 1968 ist von den Protestritualen aber kaum zu erwarten.
Die Symbole fehlen
Vor allem aber reflektieren gerade die Proteste des Jahres 2010, die die Massen mobilisieren und die meiste Aufmerksamkeit erreichen konnten, keine tiefen gesellschaftlichen Konfliktlinien. 1968 waren es die Ideen der Neuen Linken, die sich mit der Popkultur zu einem Generationenkonflikt verdichteten. Der Protest 2010 kristallisiert sich an Orten und Themen, die kaum dafür taugen, als Symbol für einen gesellschaftlichen Gegenentwurf zu stehen: an einem baden-württembergischen Bahnhof und an der Atomenergie, deren Ende – trotz Laufzeitverlängerung – besiegelt ist.
Aber auch heute lassen sich Spuren tieferer Konfliktlinien ausmachen, die den Humus von Protestbewegungen bilden: Da ist die „Alter-Globalization-Bewegung“, die sich bei den Sozialforen und den Protesten gegen die G8- und G20-Gipfel zeigt und für eine andere Verteilung des Reichtums auf der Erde eintritt. Und da ist die Bewegung für Bürgerrechte im Internet, die sich gegen die von der Urheberrechts-Industrie geforderten Beschränkungen des freien Informationsaustauschs und die breite Überwachung von Online-Aktivitäten zur Wehr setzt. Im „Protestjahr 2010“ haben aber gerade einmal 7500 Personen an der zentralen Kundgebung unter dem Motto „Freiheit statt Angst“ in Berlin teilgenommen.
Warum gelingt es den Initiatoren der Bewegungen also nicht, ihre Anhänger zu mobilisieren? Die Globalisierung lässt sich ebenso wie die Vorratsdatenspeicherung an keinem Ort festmachen. Die Überwachung unverschlüsselter Datenströme erzeugt ebenso wenig eindrückliche Bilder wie die Globalisierung. Bleibt der Protest also aus, weil den Bewegungen Symbole wie Castoren oder Bahnhofsgebäude fehlen? Zurzeit erleben wir, wie sich diese Bewegungen in einzelne Subkulturen umwandeln. Ob aus ihnen Protestbewegungen erwachsen, wird davon abhängen, ob die Politik in der Lage ist, sich für neue Ideen zu öffnen. 1968 tat sie es zu spät.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Hannelore Kraft – Politikerin des Jahres. Das Heft können Sie hier bestellen.