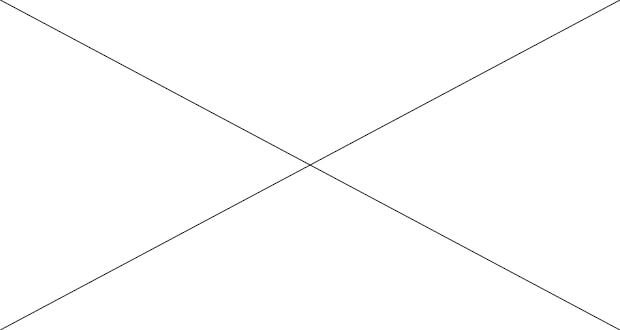p&k: Herr Schneider, Ende November hat Sarah Palin, die Galionsfigur der „Tea Party“, ihr neues Buch „America by Heart“ vorgestellt. Ist das bereits ihr Manifest für die Präsidentschaftswahl 2012?
Bill Schneider: Sarah Palin hat ihr Buch auf jeden Fall mit einer politischen Absicht veröffentlicht. In den vergangenen zwei Jahren konnte sie sich eine große Anhängerschaft aufbauen, die genau verfolgt, was sie tut und was sie sagt. Mit ihrem Buch will Palin ihre Anhänger letztlich bei der Stange halten.
Wird sich Palin um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewerben?
Das ist ungewiss. Zurzeit verfolgt sie nur eine Strategie: Sie will, dass die Amerikaner glauben, dass sie antreten könnte. Diese Diskussionen sorgen dafür, dass sie als Politikerin weiterhin ein Thema bleibt. Ganz nebenbei verdient sie mit ihren Büchern und ihren TV-Auftritten viel Geld. Würde sie morgen bekanntgeben, dass sie nicht antreten wird, wäre der Rummel um sie sofort vorbei.
George Bush hat vor kurzem gesagt, dass er Mitt Romney, den früheren Gouverneur von Massachusetts, für den besseren Kandidaten hält.
Romney ist aktuell der Kandidat mit den besten Chancen. In den USA gehen viele Beobachter davon aus, dass die Nominierung auf ihn zuläuft. Das liegt daran, dass sich die Republikaner traditionell für Politiker entscheiden, die sich bereits um die Kandidatur beworben haben. Wie zum Beispiel Richard Nixon, Ronald Reagan und John McCain. Bei den Demokraten ist das Gegenteil der Fall. Sie entscheiden sich oft für Politiker, die noch nicht angetreten sind: Barack Obama beispielsweise. Oder Jimmy Carter und Bill Clinton. Trotzdem wird es für Romney schwer.
Woran könnte er scheitern?
Zunächst einmal an seinem Glauben: Romney ist Mormone. Dann hat er in der Vergangenheit seine politischen Ansichten oft gewechselt. Außerdem ist er eng mit dem Thema Gesundheitsreform verbunden. Das liegt daran, dass er als Gouverneur 2006 ein Gesetz verabschiedet hat, dass Obamas gesundheitspolitischer Reform ähnelt. Für konservative Republikaner ein rotes Tuch.
Warum hat Bush ihn trotzdem seiner Partei empfohlen?
Die Eliten der Partei, und dazu gehört die Familie Bush, suchen einen Kandidaten, den sie unterstützen können. Mit aller Macht wollen sie Palins Kandidatur verhindern. Sie glauben nicht, dass sie mehrheitsfähig ist.
Anfang November mussten die Demokraten bei den Kongresswahlen schwere Verluste hinnehmen. Was ändert sich damit für Präsident Barack Obama?
Auf ihn kommen viele Probleme zu. Die Republikaner gehen davon aus, dass die Wähler ihnen den Auftrag gegeben haben, Obamas Pläne zu stoppen – vielleicht sogar bereits verabschiedete Gesetze rückgängig zu machen. Die Gesundheitsreform steht dabei an oberster Stelle.
Auch der ehemalige Präsident Bill Clinton bekam 1994, zwei Jahre nach seinem Amtsantritt, bei den Kongresswahlen den Unmut der Wähler zu spüren. Er rückte in die politische Mitte – und gewann die Wiederwahl. Eine Strategie für Obama?
Schwierig zu sagen. Obama hat in der Vergangenheit oft darüber gesprochen, eine überparteiliche Politik machen zu wollen. Die Kongress-Wahlen haben jedoch dazu geführt, beide Parteien im Kongress noch stärker zu ideologisieren. Moderate Republikaner fürchten sich vor dem Einfluss der Tea-Party-Abgeordneten – und viele konservative Demokraten sind nicht wiedergewählt worden. Obama kann die Hand ausstrecken: Die Frage ist, ob es bei den Republikanern jemanden gibt, der sie ergreifen will.
Seit Obamas Amtsantritt ist nicht nur die Politik stärker ideologisiert; gleiches gilt für die TV-Sender. Sie haben fast 20 Jahre für CNN gearbeitet, das für neutrale Berichterstattung steht. Der konservative Nachrichtensender Fox News und sein liberales Pendant MSNBC haben CNN in den Quoten hinter sich gelassen. Ist neutraler Journalismus in den USA ein Auslaufmodell?
Nein, auf keinen Fall. Es wird auch in Zukunft immer Zuschauer geben, die Nachrichten ohne politische Agenda wollen. Möglich ist, dass das nicht auf die Mehrheit der US-Amerikaner zutrifft. Es gibt immer mehr Zuschauer, die ihre Nachrichten mit einer bestimmten politischen Färbung geliefert bekommen wollen. Für die USA ist das normal: Nicht nur TV-Sender beziehen politisch Stellung, auch Zeitungen machen das. Objektive Journalisten wird es also auch in der Zukunft geben – jedoch werden sie nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung erreichen.
Im Juli hat CNN entschieden, dass der britische Journalist Piers Morgan die Sendung des Talkshow-Veterans Larry King übernehmen wird. Morgen hat sich vor allem als Juror in Talentshows einen Namen gemacht. Will CNN in Zukunft mit Boulevard-Themen statt mit politischen Neuigkeiten punkten?
Ich kenne Piers Morgan nicht persönlich und kann seine journalistischen Fähigkeiten nicht beurteilen. Sie müssen jedoch bedenken, dass Larry King nie behauptet hat, ausschließlich Journalist zu sein. Er bezeichnet sich als Entertainer. Richtig ist, dass er viele politische Gäste in seiner Sendung hatte. Doch auch dann stand meist die Person im Vordergrund. Ich bin sicher, dass sich CNN davon überzeugt hat, dass auch Morgan diese Art Gespräche zu führen, beherrscht.
Wie hat sich die politische Berichterstattung in den vergangenen Jahren verändert?
Sie ist schneller geworden. Mittlerwerweile gibt es einen 24-stündigen Nachrichtenzyklus. Viele Verlage haben keinen festen Redaktionsschluss mehr, sondern produzieren online ununterbrochen weiter. Vor zehn Jahren kam es für Politiker darauf an, die Woche in der Berichterstattung zu gewinnen. Mittlerweile wollen sie jede Stunde gewinnen. Leider bedeutet die höhere Geschwindigkeit, dass die Fakten oft auf der Strecke bleiben.
In den vergangenen Monaten gelang es zwei TV-Moderatoren, große Demonstrationen in Washington zu organisieren. Glenn Beck von Fox News forderte mehr patriotische Werte, Jon Stewart, Moderator einer Satire-Nachrichtensendung, wollte gar duie Vernunft wiederherstellen. Warum sind diese TV-Stars so einflussreich?
TV-Moderatoren hatten in den USA immer einen großen Einfluss; das zeigt sich jetzt mehr denn je. Beck und Stewart haben es geschafft, große Anhängerschaften aufzubauen, die ebenfalls stark ideologisiert sind. Beck ist ein Held der Konservativen, Stewart einer der Jugendlichen. Bei ihren Anhängern gelten sie als Helden, bei den Politikern eher weniger. Trotzdem würden sie fast alles dafür tun, in ihren Sendungen aufzutreten.
Was bedeutet diese Entwicklung für Politik-Journalisten? 2009 zeichnete das „Time Magazine“ Stewart als vertrauenswürdigsten Nachrichtenmann der USA aus.
Stewart hat mit seiner Sendung eine Art Entertainment-Journalismus etabliert. Mit großem Erfolg: Mittlerweile ist er die wichtigste Informationsquelle für junge Amerikaner. Das mag für viele Journalisten schockierend sein, schließlich ist er ein Comedian, ein Satiriker. Stewart steht letztlich an der Spitze einer Entwicklung, die ihren Ursprung im Jahr 1996 hat.
Sie meinen die Gründung von Fox News.
Ja, denn seit diesem Jahr ist klar, dass ein TV-Sender mit dieser Art Journalismus Erfolg haben kann. Wenn Sie es denn Journalismus nennen wollen.
Sind Stewart und Beck in der Lage, politischen Druck unter dem Deckmantel des Journalismus auszuüben?
Das glaube ich nicht. Denn aus meiner Sicht sind beide keine wahrhaftigen Journalisten. Sie sind Kommentatoren, Meinungsmacher. Letztlich sind sie Stimmen, die gehört werden wollen. Stewart und Beck wissen, wie sie das erreichen können. Denn sie haben zwei Dinge erkannt. Erstens: Die USA sind das populistischste Land der Welt. Je lauter, desto erfolgreicher. Und zweitens: Die USA sind das unternehmerischste Land der Welt. Gibt es einen Markt, gibt es auch ein Produkt. Die Amerikaner wollten Entertainment-Journalismus, Jon Stewart und Glenn Beck haben ihn geliefert.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Hannelore Kraft – Politikerin des Jahres. Das Heft können Sie hier bestellen.