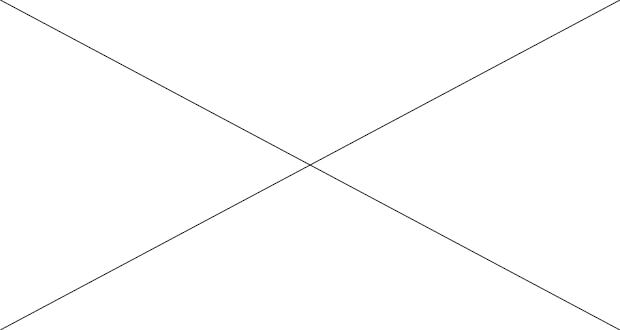Der Andrang ist so groß, dass die Veranstalter einige Gäste wieder ausladen mussten. „Die Kanzlerin“ lautet der schlichte Titel der Gesprächsrunde. An einem Sommerabend im August tritt Angela Merkel beim „Forum Pariser Platz“ im Gebäude der Dresdner Bank in Berlin auf. Der Fernsehsender Phoenix und das Deutschlandradio haben eingeladen.
Als die Bundeskanzlerin den Saal betritt, setzt Applaus ein, der eine Weile anhält. Sie lächelt. Sie ist der einzige Gast, zwei Moderatoren befragen sie zu ihrer Politik. Gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt, wirkt sie ausgeruht. Als Phoenix-Programmgeschäftsführer Michael Hirz Merkel auf ihren „präsidialen Regierungsstil“ anspricht und fragt, ob sie Sachfragen eigentlich vermeiden wolle, reagiert sie schlagfertig: Wenn das so wäre, wäre sie nicht gekommen, und sie würde ihm empfehlen, einfach loszulegen mit den Sachfragen. Heiterkeit im Saal, Applaus. Sie zeigt ihr mädchenhaftes Lächeln.
Wie der einstündige Auftritt zeigt, ist da allerdings etwas dran an der Sache mit dem präsidialen Stil. Obwohl das Gespräch für sie ein Wahlkampfauftritt ist, vermeidet Merkel scharfe Töne. Sie zeigt sich lieber als die sorgende – und angesichts der Krise ein wenig besorgte – Landesmutter. Sie sagt, dass die Wirtschaft noch nicht aus dem Schneider sei; Arbeitsplätze seien in Gefahr, und man werde sich jetzt bemühen, die Folgen der Krise gering zu halten. Auf ihre geplante „Deutschlandreise“ in einem historischen Sonderzug von Rhöndorf nach Berlin angesprochen, erklärt sie, dass das im Jubiläumsjahr der Bundesrepublik und 60 Jahre nach dem Amtsantritt Konrad Adenauers doch sehr gut passe. Einige Tage vor dem Auftritt am Pariser Platz hat sie sich schon mit Helmut Kohl fotografieren lassen. Schaut her, soll das wohl heißen, schaut her, in welcher Traditionslinie bedeutender Kanzler sie steht. Wer wollte diese Linie jetzt ohne Not abreißen lassen?
Die Union fährt eine zurückgenommene Wahlkampfstrategie und lässt die SPD einfach kommen. Diese steckt in dem Dilemma, als Juniorpartner in der Großen Koalition wie eine Oppositionspartei wahlkämpfen zu müssen – aber eben nicht in letzter Konsequenz zu können, hat sie doch die Regierungspolitik der vergangenen elf Jahre mitzuverantworten. Die erste Welle der Unions-Wahlplakate zeigt denn auch konsequenterweise die Kanzlerin und die Minister von CDU und CSU, die SPD plakatiert vor allem Inhalte. Hier zur Schau gestellte Regierungskompetenz, da ein Werben mit Botschaften, die der Wähler als Alternative zur Politik einer möglichen schwarz-gelben Koalition verstehen soll. „Die Union bemüht sich, in diesem Wahlkampf niemanden zu verschrecken“, sagt der Politikwissenschaftler Jürgen Falter. Sie lasse die Sozialdemokraten ins Leere laufen. Bisher zahle sich das aus, meint Falter, die Strategie berge jedoch Risiken: „Damit überlassen sie der SPD die Themen.“
Steinmeier setzt Themen
Themen hat Frank-Walter Steinmeier mit seinem Deutschland-Plan denn auch schon gesetzt: nachhaltiges Wirtschaften, Bildung, Gleichberechtigung. Doch Themen allein reichen noch nicht: Soll ein Wahlkampf erfolgreich sein, müssen die zentralen Botschaften landauf, landab, in griffigen Sätzen ständig wiederholt werden. „Staying on message“ sagen amerikanische Wahlkämpfer dazu. Die Medien dienen als Multiplikatoren. „Erst wenn die Botschaft den Journalisten schon zum Hals raushängt, ist sie beim Bürger angekommen“, sagt Michael Spreng, der unter anderem Edmund Stoiber im Wahlkampf 2002 beraten hat. Und daran hapere es bei Steinmeier, meint Spreng: „Bei der Vorstellung seines Kompetenzteams ist es ihm nicht gelungen, mit wenigen klaren Worten die Frage zu beantworten, was seine zentrale Botschaft ist.“
Peter Radunski, als ehemaliger CDU-Bundesgeschäftsführer ein erfahrener Wahlkämpfer, findet, dass es durchaus ein geschickter Schachzug der Genossen gewesen sei, den stellvertretenden Regierungssprecher Thomas Steg aus dem Bundespresseamt abzuziehen und ihn Steinmeier als Kommunikationsberater zur Seite zu stellen. Doch sieht auch er noch nicht den Erfolg dieser Zusammenarbeit: „Steinmeier hat bisher nur ganz wenige Sätze gesagt, die einen klaren Grundgedanken verraten – etwa den, dass diejenigen, die die Krise verursacht haben, nicht zu ihrer Lösung herangezogen werden dürfen.“ Die SPD habe „überraschende handwerkliche Probleme“, meint der Politikberater.
Dabei ist die Schlagkraft der Sozialdemokraten im Wahlkampf eigentlich gefürchtet: 1998 hatten sie mit einem modernen Wahlkampf zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik für die Abwahl eines amtierenden Kanzlers gesorgt und vor den Bundestagswahlen 2002 und 2005 einen fulminanten Endspurt hingelegt. Bei diesen früheren Wahlen kam ihnen freilich zugute, dass der Kandidat Gerhard Schröder hieß.
Die SPD hat ihre Wahlkampfmaschinerie wieder angeworfen. Doch kann sie wie 2005 den deutlichen Rückstand auf die Union praktisch wettmachen und Schwarz-Gelb verhindern?
Es gibt jemanden, der dabei ein Wörtchen mitredet: der viel beschworene unentschlossene Wähler. Nach der Wahlanalyse von Infratest dimap haben bei der vorigen Bundestagswahl 29 Prozent der Wähler erst in den letzten Tagen vor der Wahl entschieden, welche Partei sie wählen. 13 Prozent entschieden sich erst am Wahltag selbst. Das lässt es für die Parteien umso lohnender erscheinen, viel Energie in die Schlussmobilisierung zu stecken. Einen so genannten Last-Minute-Swing könne man nie ausschließen, sagt Infratest-Geschäftsführer Richard Hilmer. Allerdings gebe es diesmal einen wichtigen Unterschied zur Wahl vor vier Jahren: „Die Ausgangsbedingungen haben sich stark verändert. 2005 kam die SPD von etwa 28 Prozent in den Umfragen, die Union von 41. Heute befinden sich beide auf einem deutlich niedrigeren Niveau.“
Als in der Dresdner Bank der Moderator Merkel fragt, ob die Umfrageergebnisse der Union schon das Limit dessen seien, was die Partei erreichen könne, antwortet sie: „Ich lese jeden Tag etwas anderes. Wenn 40 Prozent der Wähler unentschlossen sind, werden die wohl nicht zu 100 Prozent SPD wählen“. So wird es tatsächlich kaum kommen, doch hat die SPD traditionell bessere Chancen, unentschiedene Wähler auf ihre Seite zu ziehen – denn die Union ist schneller „ausmobilisiert“. Ihre Wähler gelten als disziplinierter: Viele von ihnen sind über 60 Jahre alt und betrachten es als Pflicht, wählen zu gehen.
Die schlechten Umfragewerte der SPD, die derzeit auf maximal 24 Prozent kommt, bilden „den unteren Rahmen des Möglichen“, sagt Klaus-Peter Schöppner, Geschäftsführer von TNS Emnid. „Die SPD hat ein Potenzial von zirka 50 Prozent der wahlberechtigten Deutschen, das sie derzeit also nur zur Hälfte ausschöpft“, meint Schöppner. Allerdings gelinge es der Partei einfach nicht, „ihren Markenkern eindeutig zu positionieren“. Die SPD müsse entweder auf soziale Gerechtigkeit setzen und damit die Wähler des linken Spektrums ansprechen – oder sie müsse die der „Neuen Mitte“ ansprechen, also in den Gewässern fischen, in denen sie der Union 1998 viele Wähler abspenstig machte.
Die SPD hat im Wahlkampf vorgelegt und bereits im April ihren Entwurf für ein Regierungsprogramm vorgestellt. Schöppner hält einen so frühen Start für einen Fehler. „Die Union macht es geschickt und konzentriert sich auf die letzten drei Wochen vor der Wahl.“ Im Willy-Brandt-Haus sieht man freilich kein Problem darin, so früh in die Offensive gegangen zu sein. „Das erste frühe Opfer des Wahlkampfs ist immer die Wahlkampfplanung“, sagte SPD-Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfmanager Kajo Wasserhövel im p&k-Interview.
In den letzten drei Wochen des Wahlkampfs setzen die Parteien auf ein Bündel von Mitteln, die ihnen den Sieg bringen sollen. Zum schon seit längerem laufenden Online-Wahlkampf kommen nun die Großflächenplakate, das TV-Duell, das wegen der Millionen von Zuschauern eine besondere Wirkung entfaltet, – und herkömmliche Briefsendungen. „Ein intensives ,Direct-Mailing‘ ist sogar eines der wichtigsten Mittel in der Endphase des Wahlkampfs“, sagt Peter Radunski. In jedem Falle müsse die Botschaft an den Wähler personalisiert sein.
Im Schlussspurt ist es vor allem wichtig, dem Wähler das Gefühl von Nähe zu vermitteln. Und das geht im persönlichen Kontakt, von Angesicht zu Angesicht, immer noch am allerbesten. Daher treten die Spitzenkandidaten auf Marktplätzen in der ganzen Republik auf, 100 Auftritte sollen es bei Frank-Walter Steinmeier werden. Bei der Kanzlerin kann kaum unterschieden werden zwischen Wahlkampf und den vielen Auftritten, die das Amt mit sich bringt.
Keine Propaganda
Im Unterschied zu früher ist Wahlwerbung heute keine Einbahnstraße mehr: „Den Propagandawahlkampf von früher gibt es nicht mehr“, sagt Hans-Jürgen Beerfeltz, Bundesgeschäftsführer der FDP. Wer mit den Liberalen sympathisiert, soll im Idealfall den Wahlkampf selbst machen, sich und andere online über soziale Netzwerke mobilisieren. „Consumer generated campaigning“ nennt Beerfeltz das Rezept, mit dem praktisch alle Parteien inzwischen versuchen, die Wähler da abzuholen, wo sie ihre Zeit verbringen: Das ist bei immer mehr Menschen im Internet. Das Netz hat den Wahlkampf verändert, und zwar so sehr, dass etwa die FDP „keinen Schlussspurt im eigentlichen Sinne“ mehr macht, wie Beerfeltz sagt. Es soll einen fortwährenden Dialog mit den Anhängern gewährleisten, der auch nach der Wahl nicht mehr abreißt.
Dennoch verdichtet sich der Wahlkampf naturgemäß in der heißen Phase, auch online. So hat die CDU im Konrad-Adenauer-Haus einen Raum für die vorwiegend jüngeren Unterstützer eingerichtet, die das „TeAM Deutschland“, die Wahlkampftruppe der CDU, bilden. „TeAM“ ist die Eigenschreibweise der Partei, die beiden Großbuchstaben stehen für die Initialen der Kanzlerin. Etwa 15 Teammitglieder beantworten hier an Computern kontinuierlich Anfragen von Wählern und pflegen die Seiten von Partei und Parteispitze in den sozialen Netzwerken wie StudiVZ oder Facebook.
Die Grünen setzen das Netz zielgerichtet als Kanal für ihre Aktion „Drei Tage wach“ ein. Diese wird in der Zeit stattfinden, in der die vielen Unentschlossenen zu einer Entscheidung kommen: In den letzten 72 Stunden, bevor die Wahllokale schließen. Von 18 Uhr am Donnerstag vor der Wahl bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr ist die Wahlkampfzentrale immer besetzt. Online-Anfragen von Wählern sollen umgehend beantwortet werden – wenn es sein muss, auch nachts. Klassische Telefon-Hotlines sind ebenfalls geschaltet.
Wen Spätentscheider wählen
Für die kleineren Parteien spielen die letzten 72 Stunden eine besonders große Rolle: Gerade die Wähler von Grünen, FDP und Linke entscheiden sich spät, laut Infratest-Analyse waren es im Jahr 2005 bei Grünen und FDP sogar jeweils 20 Prozent der Wähler, die sich erst in dieser Zeit festlegten. Wenn Wechselwähler womöglich noch von einer Partei zur anderen umschwenken, tun sie das in der Regel innerhalb des Lagers; in diesen seien „die Hürden für Wechselwähler sehr niedrig“, sagt Richard Hilmer. Darum müssen die Grünen die Arme für Wähler offen halten, die auch der SPD zugeneigt sind, die FDP für solche, die unter Umständen CDU wählen würden.
Die an der Regierung nicht beteiligten Parteien haben gemeinsam, dass sie in Zeiten der Großen Koalition über eine deutlich geringere Medienpräsenz verfügen – obwohl sie die in einer parlamentarischen Demokratie so wichtige Opposition stellen. „Der ständige Rosenkrieg der Großen Koalition überlagert alles“, sagt die Grünen-Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke. Darum hatten Grüne und Liberale von den Öffentlich-Rechtlichen auch gefordert, ebenso wie Merkel und Steinmeier „Townhall-Meetings“ zu bekommen, also Sendungen, in denen die Kandidaten einem ausgewählten Publikum Rede und Antwort stehen. Das sei „dem Kampf gegen die Langeweile zuträglich“ und würde zudem „der demokratischen Meinungsbildung nutzen“, begründete Lemke die Forderung. Die Fernsehsender lehnten ab: Es gebe nur Meetings mit den Kandidaten, die eine realistische Chance hätten, Bundeskanzler zu werden.
So also muss Steinmeier jetzt den Oppositions-Kandidaten spielen, während die Kanzlerin ihre Regierungspolitik erklärt. Für die SPD kommt es jetzt auf das an, was die Amerikaner „Momentum“ nennen: auf ein Geschehen, das der Kampagne auf wundersame Weise Durchschlagskraft verleiht. Das könnten gewonnene Landtagswahlen am 30. August sein oder gar eine Panne in einem Atomkraftwerk. Die Union jedenfalls ist in der komfortablen Situation, nicht auf ein Momentum hoffen zu müssen.
Von Kollegen des eigenen Senders befragt, wie es denn sei, die Kanzlerin zu interviewen, sagte Phoenix-Moderator Michael Hirz: Da steige das Adrenalin. Die Bundeskanzlerin habe schließlich eine von der Verfassung herausgehobene Position und sei daher nicht vergleichbar mit den „meisten anderen Funktionsträgern“. Im Wahlkampf jedenfalls ist diese herausgehobene Position nicht unbequem. Darin lässt es sich bestens abwarten.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Jetzt aber los! – Endspurt zur Bundestagswahl. Das Heft können Sie hier bestellen.