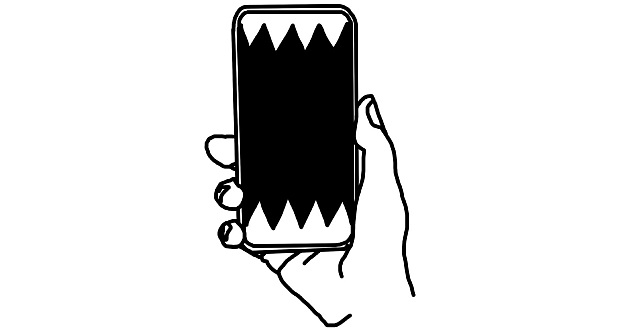Mittlerweile gehört es zur Jobbeschreibung von Journalisten, Politikern und anderen in der Öffentlichkeit stehenden und arbeitenden Personen, dass sie mit dem ausgestellten Hass in den sozialen Medien umgehen müssen. Hass gehört selbstverständlich zu den erwarteten Reaktionen, man rechnet mit ihm. Und vielleicht ist das Teil des Problems.
Meine eigene Erfahrung mit dem Hass im Netz würde ich in drei Phasen unterteilen, vielleicht findet sich der eine oder andere Leser in ihnen wieder.
Wie ich Twitter zu schätzen lernte
Phase eins war geprägt von einem neugierigen und, wie ich heute weiß, naiven Umgang mit Facebook und Twitter. Ich habe die sozialen Netzwerke nie als privates Kommunikationsmittel gesehen, immer eher als die Erweiterung des beruflichen Werkzeugkastens. Es waren die Gezi-Park-Proteste 2013 in Istanbul, in deren Verlauf ich wie viele anderen Kollege Twitter besonders zu schätzen gelernt haben. Zum einen als Quelle, weil die unterschiedlichen politischen Gruppen und Demonstranten dort ebenfalls sehr aktiv waren und ihre Ansichten teilten. Außerdem konnte man oft sehr exakt verfolgen, wo gerade Demonstranten und Sicherheitskräfte aufeinanderstießen. Es war eine Zeit, in der das Internet als Katalysator politischer Willensbildung und Instrument einer globalen Demokratieentwicklung gesehen wurde, ob auf dem Tahrir-Platz in Kairo, im Gezi-Park in Istanbul oder später auf dem Majdan-Platz in Kiew.
Diese Phase könnte man auch “Einfach-drauflos-Phase” nennen. Oft habe ich die Ereignisse, deren Zeugin ich war, oder die interessanten Gespräche, die ich führen konnte, in Echtzeit reportiert. Und früh an den Reaktionen gemerkt, was für ein großes Interesse es in Deutschland dafür gab. Oder richtiger: Im Netz, was nicht immer deckungsgleich ist mit “der” deutschen Gesellschaft. Mein Eindruck ist, dass in dieser Zeit noch die professionellen “Sender” die Debatten dominierten und die Empfänger, also die Konsumenten der Inhalte der professionellen Sender, sich wenig einbrachten.
Die Suche nach dem richtigen Umgang mit der Wut
In Phase zwei änderte sich das. Sie wurde dominiert vom Schock über das, was da an Wut zurückkam aus dem Netz, und von der Suche nach dem richtigen Umgang damit. Teilweise waren mir die Reaktionen nicht gänzlich unbekannt, da ich zuvor, neben vielen positiven und konstruktiv kritischen Leserbriefen, auch Erfahrungen mit wutentbrannten Zuschriften gemacht hatte. Doch die Massivität, die Ad-hoc-Reaktion und der Ton waren neu. Ich könnte heute gar nicht genau sagen, wann diese Phase begann. Aber es wurde sehr schnell klar, worum es den Kommentatoren hauptsächlich ging: um meine Herkunft. Oft waren und sind Texte, in denen es um Migration und Flüchtlinge geht, um die Türkei oder den richtigen Umgang mit diesem Land beziehungsweise Staatspräsident Erdoğan oder um den NSU-Fall, Auslöser für heftigste verbale Ausfälle.
In dieser Phase habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass viele meiner deutsch-deutschen Kollegen das Problem noch gar nicht kannten. Sie erhielten diese Art von Mails oder Postings selten oder gar nicht. Noch nicht. Meine anderen Kollegen, jene, deren Eltern ebenfalls Einwanderer sind, und ich sahen uns dagegen mit wüstesten Beschimpfungen, Todeswünschen, Morddrohungen und Vergewaltigungsfantasien konfrontiert.
Es gab zu jener Zeit noch wenig Bewusstsein und entsprechend wenig Solidarität mit den Betroffenen. Es passierte ja schließlich “im Netz”, nicht im realen Leben. Diese überholte Sicht auf das Internet erklärt für mich zumindest, warum sich der Hass so stark etablieren konnte, dass er zu einem selbstverständlichen Teil der Kommunikation wurde. Man begegnete den Leuten ja nicht wirklich, die einen “Mohammedanerweibchen” oder “asoziales Gesindel” nannten – oder, aus einer anderen Richtung, “Zionistenpüppchen”, “Hunde, die sich an den Westen verkauft haben”; “Für das, was du tust, Özlem, gibt es nur ein Ende: die Todesstrafe”. Den anonymen Absender dieses letzten Beispiels habe ich angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, weil sie die Person nicht ermitteln konnte.
Wie viele andere Betroffene habe ich anfangs noch versucht, den Hass-Schreibern zu kontern, mich zu verteidigen. Nur, wie verteidigt man sich gegen jemanden, der einem eine Vergewaltigung auf der Domplatte wünscht? Was sagt man dem? Diese Phase führte in die Defensive. Es gab in dieser Zeit noch keinen geeigneten Raum, um den Hass zu thematisieren und öffentlich auszustellen. Dann kam Hate Poetry und damit Phase drei. Sie bewegte sich zwischen offensivem Umgang mit Hasszuschriften bei gleichzeitigem Ignorieren, Versachlichen und, wenn alles nicht hilft, Blockieren.

Auftritt der Hate-Poeten Deniz Yücel, Özlem Topçu und Mely Kiyak: “den Scheiß zurück in den Orbit schießen”. (c) Sascha Rheker
Die freie Berliner Journalistin Ebru Taşdemir zerbrach sich bereits 2012 den Kopf darüber, was man mit rassistischen Leserbriefen, die sie und andere Kollegen mit nicht deutschen Namen erhielten, machen sollte. Sich nur darüber aufregen und das Gelesene in kleinen Selbsthilfegruppen aufarbeiten, als hätte der Rest der Gesellschaft nichts damit zu tun, erschien auf Dauer wenig attraktiv und unpolitisch – anders als die ihnen entgegenschlagende Wut, die sehr politisch war. Aber genau das war es: “Die” Gesellschaft sollte nicht länger unbeteiligt sein, sondern von dem Hass erfahren. Nur, wie kriegt man Leute dazu, dass sie einer Gruppe von Journalisten 90 Minuten dabei zuhören, wie sie schlimmste Dinge vortragen? Wie dazu, dass sie schlechte Laune riskieren oder gar nicht erst kommen, weil sie eine Opferinszenierung erwarten?
Der Absender von Hass wird in die Öffentlichkeit gezerrt
Es gab nur eine Lösung: Konfetti. Und das ist nicht allein metaphorisch gemeint. Konfetti, Luftschlangen, reichlich Alkohol und eine Tischdekoration, bestehend aus jedem nur vorstellbaren Tinnef, der für das Einwanderungsland Deutschland steht, begleiteten den Vortrag der Hassbriefe und -mails auf vielen Theaterbühnen des Landes. Es entstand eine Inszenierung (und entwickelte sich fortwährend weiter), die den vorgetragenen Hass noch absurder erscheinen ließ, aber auch ertragbarer. Es gelang, den “Scheiß wieder in den Orbit zurückzuschießen”, wie mein Kollege Yassin Musharbash immer gern erklärte.
Dieser “Scheiß” gehörte nämlich nicht den Adressierten von Hass, den Vortragenden, allein. Hate Poetry kehrte die Machtverhältnisse um: Der Absender von Hass, geschützt in seiner Anonymität und Nichtöffentlichkeit, wird in die Öffentlichkeit gezerrt, wenn auch nur mit dem, was er geschrieben hat; gefragt wird er nicht. Diese Entscheidung wird an ihm vorbei getroffen, der Hass thematisiert und politisiert. Die Hate-Poeten wollten nicht auf der Wut sitzen bleiben, da sie ein Produkt der gesellschaftlichen Atmosphäre war und ist. Einer Atmosphäre, in der die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben werden, während gleichzeitig viele das Gefühl haben oder zumindest demonstrieren, ganz sicher aber instrumentalisieren, dass man “ja gar nichts mehr sagen dürfe”.
Eskortiert wird dieses Gefühl von einer Partei, deren Vertreter und Anhänger nicht nur in den sozialen Netzwerken andere verächtlich machen, sondern sogar vor dem deutschen Bundestag von “Messermännern” und “Kopftuchmädchen” sprechen (und mit Sicherheit auch Opfer von Hasszuschriften sind, es ist ambivalent). Es ist nicht das Problem, dass man “ja gar nichts mehr sagen darf”, sondern, dass viele Menschen sehr viele schlimme Dinge sagen, aber vergessen, dass sie Verantwortung für ihre Worte tragen. Dass sie Meinungsfreiheit mit Deutungshoheit verwechseln, wie Friederike Haupt kürzlich in der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” schrieb. Und dass sie zu ignorieren scheinen, dass Worte etwas bedeuten und bewirken können. Ja, sogar eine gesellschaftliche Stimmung schaffen, in der nicht einmal mehr politische Morde oder Angriffe ausgeschlossen werden können.
Mittlerweile sind sehr viele Journalisten und Politiker von Anfeindungen im Netz betroffen, nicht mehr allein jene mit nicht deutschen Namen. Da sitzt eine Ursula von der Leyen auf einer Bühne und erzählt, dass kaum noch eine Hassmail ohne das Wort “Fotze” auskomme. Peter Tauber liest einen Brief vor, in dem er als “krebsinfiziertes Stück Scheiße” bezeichnet wird. Omid Nouripour als “Zigeuner” und Katrin Göring-Eckardt als “grünes Dreckspack” oder “Amischlampe”. Diese und noch viel schlimmere Dinge über sich zu lesen, schmerzt wohl jeden Menschen, auch wenn bei dem einen oder anderen eine Gewöhnung eintreten mag. Vielleicht eintreten muss.
Man muss dieses Spiel nicht mitspielen
Natürlich kann man nicht für immer Hassbriefe vorlesen und hoffen, dass die Zivilisierung der Debatte irgendwann eintritt wie in einer Art Evolution. Aber kein Twitter ist auch keine Lösung. Den sozialen Netzwerken den Rücken zu kehren, wie es einige Politiker getan haben, ist der falsche Weg. Es ist eine Kapitulation vor dem Hass und zeugt von der absurden Annahme, dass die Technik böse sei und somit den Menschen auch böse mache. Als sei dieser nicht mit einem Willen ausgestattet.
“Twitter ist wie kein anderes digitales Medium so aggressiv, und in keinem anderen Medium gibt es so viel Hass, Böswilligkeit und Hetze. Offenbar triggert Twitter in mir etwas: aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter zu sein – und das alles in einer Schnelligkeit, die es schwer macht, dem Nachdenken Raum zu lassen. Offenbar bin ich nicht immun dagegen”, schrieb Grünen-Co-Vorsitzender Robert Habeck Anfang des Jahres als Begründung, warum er seine Accounts bei Facebook und Twitter gelöscht habe (darüber hinaus gab es auch noch einen Datendiebstahl).
Nun, man muss dieses Spiel ja nicht mitspielen, man kann sich dem Getriggertwerden entziehen, die Geschwindigkeit drosseln, nicht sofort kommentieren, sondern einen Schritt zurücktreten und durchatmen, die Polemik dosieren und differenziert Debatten führen – wie in der analogen Welt auch. Man kann sich dazu erziehen, nicht nach jedem Auftritt in einer Talkshow Twitter zu fragen: “Schatz, wie war ich?” Es ist schwer, aber es geht.
Man kann und sollte noch etwas tun: Solidarität mit jenen zeigen, die angegriffen werden, niemand hindert einen daran. Ähnlich der empfohlenen Verhaltensweise in der “echten” Welt, wenn man Zeuge eines Angriffs auf eine andere Person wird, in der S-Bahn etwa: den Bedrohten ansprechen, nicht den Drohenden, ihn unterstützen und ihm den Platz neben sich anbieten.
Die Art, wie wir uns in den sozialen Netzwerken bewegen und aufführen, folgt keinem Determinismus, es ist auch kein Voodoo, da unbeschadet wieder rauszukommen. Es mutet als Spitzenpolitiker etwas seltsam an, ein Medium auf diese Weise zu verurteilen, das Millionen von Bürgern friedlich nutzen. Ganz davon abgesehen, dass man Twitter und Facebook so wenig ausschließen sollte wie die Kandidatur um Vorsitze oder Ämter. Es kommt ja oft anders, und dann sieht man immer blöd aus.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 128 – Thema: Wandel. Das Heft können Sie hier bestellen.