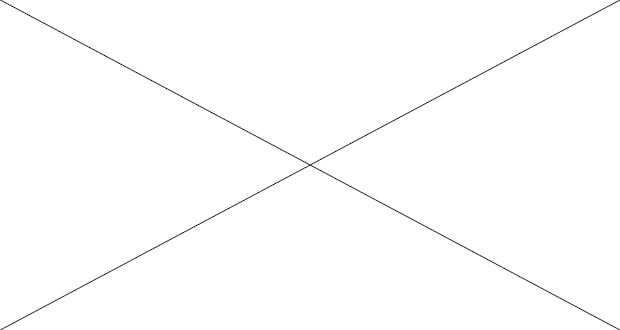Die Befürchtungen waren schrecklich. Der Kölner Regierungspräsident Franz-Josef Antwerpes formulierte es drastisch: Wenn die Politik weggehe, werde Bonn zur Geisterstadt. Bundeshaus und Kanzleramt wären am Ende nur noch Ruinen. Und der Bonner Oberbürgermeister Hans Daniels zeichnete ein ebenso düsteres Bild: Es werde der „komplette Abbruch Bonns vorbereitet“.
Als 1991 entschieden war, dass Bundestag und Regierung nach Berlin ziehen, stand Bonn am Scheideweg – was würde bloß aus der Stadt werden?
Wer heute während der Woche vormittags am Bonner Rheinufer entlanggeht, dem begegnen nicht sehr viele Menschen. Die Wintersonne glitzert auf dem majestätisch dahinfließenden Rhein. Manchmal überholt ein schnaufender Jogger, eine alte Dame geht mit dem Hund spazieren. Dann eilt aber auch mal eine Gruppe von Anzugträgern mit bedeutenden Mienen über die Promenade – im alten Bundesviertel finden sich mittlerweile nicht nur zahlreiche Uno-Organisationen, auch die Deutsche Welle hat hier ihren Sitz. Und nebenan kann – sagen wir – der Chef einer Versicherung vor Hunderten von begeisterten Mitarbeitern staatsmännisch seine Bilanz vortragen – am Rednerpult des früheren Bundestags-Plenarsaals. Dieser ist inzwischen Teil des „World Conference Center“, eines Kongresszentrums im Herzen des alten Bundesviertels.
Bonn ist eine ruhige und bürgerliche Stadt, aber das war es auch schon, als die Regierung hier war. Genau so eine Stadt hatte man gesucht, als die Bundesrepublik nach dem Krieg Bescheidenheit demonstrieren wollte. Wirtschaftlich blüht Bonn und steht sogar besser da als früher: Es gibt mehr Einwohner und mehr Beschäftigte als zuvor. Und immer noch arbeiten fast 9000 Bundesbeamte hier.
Nicht zu vergessen die Nachfolge-Unternehmen der Bundespost: Der moderne Glasturm der Deutschen Post überragt heute den „Langen Eugen“, das ehemalige Abgeordnetenhaus; der Turm ist sogar höher als der Kölner Dom, ein im katholischen Rheinland nur schwer vorstellbares Faktum. Auch die Telekom hat in Bonn ihren Sitz.
Eine Geisterstadt ist das keineswegs, obwohl der Geist der Bonner Republik noch immer präsent ist und manch einer hier melancholisch wird, wenn von der Vergangenheit die Rede ist – oder gar ein bisschen wütend, wenn die Gefühle aus der Zeit des Hauptstadtstreits wieder hochkommen.
***
20. Juni 1991: Der Deutsche Bundestag entscheidet über den Parlaments- und Regierungssitz. Vor dem Wasserwerk, in dem das Parlament übergangsweise tagt, weil ein neuer Plenarsaal gebaut wird, steht ein Zelt, in dem nach der Abstimmung gefeiert werden soll. Der ganze Tag ist für die Debatte vorgesehen. „Abstimmung nicht vor 18 Uhr“, heißt es in der Tagesordnung.
Die beiden Lager in der Hauptstadtfrage haben den Kampf in den vergangenen Monaten immer erbitterter geführt. Die Bonner betreiben eine beispiellose Kampagne für ihre Stadt, mehrere Initiativen von Bürgern und Politikern machen sich für einen Verbleib der Institutionen am Rhein stark. „Ja zu Bonn“ heißt die größte dieser Initiativen. Der spätere Inhaber des Berliner Lokals „Ständige Vertretung“ hat sie mitbegründet: Friedel Drautzburg, der aus der Eifel stammt, aber in Bonn zum Rheinländer sozialisiert wurde. Ein früherer Studentenbewegter, der mit Politikern ersten Ranges auf Du und Du steht. In seinem Restaurant, dem „Amadeus“, läuft jetzt der Fernseher – die Debatte wird übertragen wie ein Fußball-Länderspiel. Wie ein WM-Finale. Der Champagner ist schon kaltgestellt, denn Bonn scheint keine schlechten Chancen zu haben.
Die Hauptstadtfrage lässt ungeahnte Bündnisse über Parteigrenzen hinweg entstehen. So sind etwa Horst Ehmke, ehemaliger Bundesjustizminister und Kanzleramtschef von Willy Brandt, Bundesarbeitsminister Norbert Blüm und NRW-Ministerpräsident Johannes Rau für Bonn. Für Berlin sprechen sich Bundespräsident Richard von Weizsäcker aus, Altkanzler Willy Brandt selbst und sein politischer Weggefährte Egon Bahr. In der CDU-Fraktion macht Editha Limbach, direkt gewählte Abgeordnete für Bonn, eine Unterschriftensammlung pro Bonn. Horst Ehmke tut das Gleiche bei den Abgeordneten der SPD. Dabei kam jeweils eine Mehrheit für Bonn heraus. Umfragen unter den Bundestagsabgeordneten deuten ebenfalls auf eine Mehrheit für Bonn, und die Umfragen in der Bevölkerung zeigen, dass die Stimmung günstig ist für die kleine rheinische Großstadt.
***
An der Bonner Görresstraße stehen auch im Jahr 2009 noch die Gebäude, in denen früher Bundestag und Bundesrat tagten. Das Bundeshaus gehört zum Kongresszentrum, das derzeit um einen riesigen Neubau und ein Hotel erweitert wird. Die Baustelle direkt gegenüber vom Bundeshaus dominiert das Areal. Wo heute gebaut wird, stand bis vor kurzem seit den 50er Jahren das „Bundesbüdchen“, der Kiosk von Jürgen Rausch. Der Kiosk steht inzwischen unter Denkmalschutz, weil er Nierentisch-Flair verströmt und ein stiller Zeuge des bundesrepublikanischen Parlamentarismus ist. Doch störte er beim Neubau des Kongresszentrums, wurde deshalb mit großem Aufwand abtransportiert, eingelagert und soll nun im Laufe des Jahres wieder an seinen alten Platz gebracht werden. Rausch versorgt derweil in einem hölzernen Provisorium neben dem alten Bundeskanzleramt die Bauarbeiter mit Kaffee, Zigaretten und Würstchen. Seit 1984 ist er Inhaber des Bundesbüdchens. „Bei uns holten sie sich alle ihre Zigaretten und ihre Zeitungen, von der Reinigungskraft bis zum Bundeskanzler“, erinnert er sich. „Die Kanzler sind gern mal ausgebüxt und ganz ohne Sicherheitsleute durch das Viertel spaziert. Die Personenschützer vom Bundeskriminalamt haben mir mal erzählt, dass das für sie immer ganz großer Stress ist. Die haben die Kanzler am liebsten immer nur im Auto überall vorgefahren.“ Bei Rausch holte sich auch Joschka Fischer seine Zeitungen. „Als der immer so viel gejoggt ist, habe ich ihm oft mal die ,Fit for Fun‘ mitgegeben, wenn da was zum Thema Laufen drin war.“
Und als Oskar Lafontaine als Finanzminister das Handtuch warf, da sei der vormalige Außenminister Klaus Kinkel aus dem Bundeshaus gekommen und habe schadenfroh herübergerufen: „Die haben keinen Finanzminister mehr!“ „Da habe ich dann zu dem gesagt: Na und, Sie haben doch auch keinen mehr.“
Beim Schwatz am Bundesbüdchen testete mancher Politiker seine Ideen erstmals am „kleinen Bürger“, sagt Rausch. „Das war alles immer sehr nett und familiär. Trotzdem mache ich mir keine Illusionen darüber, dass die in mir jemals mehr als diesen kleinen Bürger gesehen haben.“ Das Familiäre aber, das war prägend für die Bundeshauptstadt Bonn.
***
20. Juni 1991: Die Bonner CDU-Abgeordnete Editha Limbach betritt den Plenarsaal im Wasserwerk. Sie hat kein gutes Gefühl. Einige der Fraktionskollegen verhalten sich in letzter Zeit irgendwie komisch. Innenminister Wolfgang Schäuble hat hinter den Kulissen für Berlin getrommelt, manche sagen heute auch: „Druck gemacht“. Mit Limbach hat er ebenfalls gesprochen, das Gespräch verlief aber durchaus fair: Er sagte ihr, dass Deutschland Berlin als repräsentative Hauptstadt brauche. Sie antwortete, dass sie das anders sehe. Schäuble: „Dann muss ich das akzeptieren.“
Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich in der Frage des Regierungssitzes zunächst eher bedeckt gehalten. In einer Fraktionssitzung bekannte er sich dann aber zu Berlin – da ließ sich manch ein Abgeordneter noch einmal sein ursprüngliches Votum durch den Kopf gehen. Nun, am Tag der Abstimmung, trifft Limbach im Plenarsaal auf KarlHeinz Schmitt, den altgedienten Chef der Bundestags-Saaldiener, der seinen letzten Arbeitstag hat, bevor er in den Ruhestand geht. „Frau Limbach, glauben Sie, dass das heute gut geht?“, fragt der Rheinländer. „Ich glaube nicht“, antwortet Limbach.
***
Ekkehard Kohrs arbeitet seit vielen Jahren für den Bonner „Generalanzeiger“ als politischer Korrespondent. Bis zum Jahr 2007 schrieb er seine Texte noch immer vom alten Bonner Pressezentrum in der Straße „Im Tulpenfeld“ aus, weil er darauf verzichtet hatte, mit der Parlamentsredaktion nach Berlin zu gehen. Bis zum Regierungsumzug war hier der Hauptsitz der Bundespressekonferenz, waren hier die Büros der in- und ausländischen Korrespondenten. Auch heute sind immer noch „FAZ“, „Süddeutsche“, dpa und einige Fachblätter vor Ort. Die Redakteure kümmern sich um Nordrhein-Westfalen und die Rheinschiene, um die Deutsche Post und die Telekom.
Kohrs trifft man mittlerweile im Haupthaus des „Generalanzeiger“, das in einem Gewerbegebiet liegt. In der Redaktion ist hier und da noch ein Aufkleber mit der Botschaft „Ja zu Bonn“ zu erspähen. Es ist leicht, sich vorzustellen, dass die Debatte um den Umzug die Redaktion nicht kalt ließ.
„Für die ausländischen Kollegen war der ,Generalanzeiger‘ so etwas wie die ,Washington Post‘ von Deutschland“, erinnert sich Kohrs. Denn bis zum Regierungsumzug war das Blatt eine Hauptstadtzeitung wie heute „Tagesspiegel“ und „Berliner Zeitung“ – Regionalzeitungen zwar, aber solche, die selbstbewusst auch einen überregionalen Anspruch erheben. Der amerikanische Journalisten-Haudegen Don Jordan holte sich denn auch jeden Morgen in der Parlamentsredaktion des ,Generalanzeiger‘ sein Exemplar der Zeitung ab. „Die deutschen Kollegen haben uns allerdings eher als Lokalzeitung gesehen“, sagt Kohrs. „Da hat es uns natürlich gefreut, dass Helmut Schmidt immer sagte, er lese den Generalanzeiger gerne, der sei am aktuellsten. Wir hatten tatsächlich den spätesten Redaktionsschluss von allen. Das hat die anderen dann schon ein bisschen geärgert.“
Unmittelbar nach dem Umzug war noch nicht erkennbar, welche Blüte Bonn bald wieder erleben sollte. Zwar war da schon eine Vielzahl von Kompensationsleistungen für die Stadt beschlossen, die sich nun „Bundesstadt“ nennen durfte, das Regierungsviertel stand aber tatsächlich ab dem Sommer 1999 zunächst leer. Kohrs: „Eines Morgens fuhr ich mit dem Auto zum Büro und stellte fest, dass alles voller Ratten war. Also habe ich in der Redaktion angerufen und den Kollegen gesagt, dass sie ihren Kommentar bitte selbst schreiben sollen. Ich bin nicht ausgestiegen, sondern lieber wieder gefahren.“
***
20. Juni 1991: Auf dem Bonner Marktplatz versammeln sich schon morgens Bürger, um die Debatte im Wasserwerk auf einer Großbildleinwand zu verfolgen. Auf dem Marktplatz, auf dem Charles de Gaulle 1962 rief: „Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!“ Auf dem Platz, auf dem die Bonner schon Kennedy und Gorbatschow bejubelt haben. Viele der hier Versammelten sind Beamte, viele haben Geschäfte oder sind Dienstleister und leben indirekt von Parlament und Regierung. Müssen sie womöglich mit der ganzen Familie umziehen, wenn die Entscheidung zu Gunsten von Berlin fällt?
Im Wasserwerk beginnt um 10 Uhr die Debatte, die Pressetribüne ist voller Journalisten. Im Plenum ist es noch enger, als es in dem Behelfsparlament ohnehin sonst schon ist.
Der Fraktionszwang ist aufgehoben. Bonn hat Aufschlag: Arbeitsminister Norbert Blüm, einer der engagiertesten Bonn-Befürworter, spricht als Erster. Der gerne humorvoll auftretende Blüm würdigt zwar die historische Tragweite der Entscheidung, doch verliert er sich im Klein-Klein von Zweckmäßigkeitserwägungen: „Lasst dem kleinen Bonn Parlament und Regierung!“ ruft der Minister. Berlin bekäme als Hauptstadt doch so viele Probleme, meint er: „Wohnungsprobleme, Raumordnungsprobleme, Infrastrukturprobleme“. „Ersparen wir Berlin den Weg in eine Megastadt!“ Der Aufschlag war verschenkt.
Rund 100 Redner kommen in den folgenden fast elf Stunden zu Wort. So spricht etwa Wolfgang Thierse für Berlin und Friedbert Pflüger, der Jahre später als Oppositionsführer im Berliner Abgeordnetenhaus scheitern wird, plädiert für Bonn. Heiner Geißler hat einen Kompromiss-Antrag eingebracht, nach dem Parlament und Regierung auf Bonn und Berlin aufgeteilt werden sollen.
Im Restaurant „Amadeus“ richten sich in diesen Stunden die Blicke der Anwesenden immer wieder auf Friedel Drautzburg, der sich doch so sehr als Bonn-Kampagnero exponiert hat. Er hat demonstriert, Anzeigen geschaltet und Medienauftritte absolviert. Er hat bisher an eine Entscheidung für Bonn geglaubt, doch schlagen die „Berliner“ sich in der Debatte rhetorisch ziemlich gut. Inzwischen macht sich das Gefühl in ihm breit: Die Sache könnte kippen.
***
Nicht weit vom provisorischen Holzkiosk von Jürgen Rausch betreibt Udo Münch seinen Friseursalon. Der Salon lag früher direkt in der Ladenzeile im Bundeshaus, er hieß quasi-offiziell „Friseursalon Deutscher Bundestag“. Münch arbeitete dort von 1979 an. Bundeskanzlern und Ministern, Abgeordneten und Journalisten hat er die Haare geschnitten. In seinem Salon steht – als sei sie ein Familienmitglied – ein gerahmtes Foto der 2008 verstorbenen früheren Bundestagspräsidentin Annemarie Renger. Renger war Stammkundin bei Münch.
All die Jahre hat der Friseur aus seinem Salon den parlamentarischen Betrieb beobachten können. So habe er schon manchen Parlamentsneuling erlebt, der eine Abstimmung vergessen habe und bei Ertönen des Klingelzeichens, das in den Plenarsaal rief, noch mit Halskrause aus dem Salon gestürmt sei. Eines sei für ihn auffällig am Verhalten der Abgeordneten gewesen: „Im Plenarsaal riefen die immer Zeter und Mordio – wenn die dann aus dem Saal rauskamen, waren sie immer nett zueinander.“
Münch hätte 1999 mit dem Bundestag nach Berlin gehen können. „Man hat mir angeboten, in Berlin wieder ein Ladenlokal zu pachten. Bis das bezugsfertig gewesen wäre, hätte es allerdings zwei Jahre gedauert. Also bin ich geblieben.“ Sein Nachbar in der Ladenzeile im Bundeshaus entschied anders: Ben Maderspacher, Inhaber der Parlamentsbuchhandlung, ging mit nach Berlin und arbeitete dort mehrere Jahre in einem Hinterhof-Provisorium, bevor er an seinen jetzigen Standort an der Wilhelmstraße zog.
Den Salon innerhalb Bonns zu verlegen, kam für Udo Münch nicht in Frage: Von Kindesbeinen an sei er mit dem Viertel verbunden. Die Befürchtung, dass nach dem Umzug keine Kunden mehr kommen, erwies sich als unbegründet. „Es wurde ruhiger, doch pendelten viele Journalisten und Beamte und kamen dann am Freitag oder Samstag zu mir.“ Norbert Blüm und Hans-Dietrich Genscher lassen sich heute noch bei ihm die Haare schneiden.
***
20. Juni 1991: Im Wasserwerk spricht Innenminister Wolfgang Schäuble, der seit einem dreiviertel Jahr im Rollstuhl sitzt. Schäubles Rede ist die entscheidende Rede des Tages. Willy Brandt gratuliert ihm später dazu, und der berühmte Rhetorik-Professor Walter Jens wird die Rede mit denen des römischen Rhetors Cicero vergleichen. Schäuble hebt die Debatte gewissermaßen auf eine höhere Ebene: Es handle sich hier nicht um einen „Wettkampf zwischen zwei Städten“, keinen Wettkampf zwischen Bonn und Berlin. „Es geht auch nicht um Arbeitsplätze, Umzugs- oder Reisekosten, um Regionalpolitik oder Strukturpolitik“, sagt Schäuble. „Das alles ist zwar wichtig, aber in Wahrheit geht es um die Zukunft Deutschlands.“ Die Entscheidung für Berlin, meint der Minister, sei eine „Entscheidung für die Überwindung der Teilung Europas“. Nach der Rede erhält er stehende Ovationen. Die Menschen auf dem Bonner Marktplatz sehen ihre Felle davonschwimmen.
Weil der Redemarathon mit Elan geführt wird, aber eben doch ein Marathon ist, verzichten viele Abgeordnete und geben ihre Rede zu Protokoll – unter dem Beifall der Kollegen. Der SPD-Abgeordnete Hermann Scheer zieht sich hingegen ihren Unmut zu, weil er seine Redezeit überzieht.
Und dann, es ist schon nach 21 Uhr, läuft die Auszählung der Stimmen. Die Spannung ist unerträglich. Da beobachtet „Generalanzeiger“-Korrespondent Ekkehard Kohrs von der Pressetribüne aus, wie Kanzleramtsminister Rudolf Seiters zu einem Journalisten auf der Pressetribüne schaut und lautlos mit den Lippen ein Wort formt: „Berlin“. Das Ergebnis war schon durchgedrungen. Der Journalist versteht, dreht sich zum Bonner Oberbürgermeister Hans Daniels um und zeigt mit dem Daumen nach unten. Daniels wird blass.
Gegen zehn vor zehn verkündet Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth das Ergebnis dann offiziell: 337 Stimmen für Berlin, 320 für Bonn. Die Gewinner jubeln, auf dem Bonner Marktplatz fließen Tränen. In Friedel Drautzburgs Restaurant: Tränen. Als Süssmuth die Sitzung mit den Worten „Jetzt wird gefeiert“ schließt, ist die Bonner Abgeordnete Editha Limbach verärgert. Sie geht nicht in das Zelt, das vor dem Wasserwerk steht. Sie geht in ihr Abgeordnetenbüro, um eine Stellungnahme zum Beschluss zu versenden.
***
Nach der Entscheidung akzeptiert nicht jeder das Votum, vier Abgeordnete klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den 1992 zwischen dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg geschlossenen Hauptstadtvertrag. Bonner demonstrieren weiterhin jeden Donnerstagabend auf dem Marktplatz. Einige von ihnen müssen sich nun entscheiden: bleiben oder gehen?
Im „Haus Daufenbach“, dem Lokal, das Friedel Drautzburg gemeinsam mit seinem Kompagnon Harald Grunert betreibt, sitzen regelmäßig die Journalisten des Hintergrundkreises „Gelbe Karte“ zusammen. Einer beklagt sich irgendwann: „Was machen wir in Berlin denn ohne euch?“ Allgemeines Wehklagen. „Kommt doch mit!“ schlägt jemand schließlich vor. Drautzburg erinnert sich später: „Da fingen wir an, nachzudenken. Wir sagten uns: Wenn 40.000 Rheinländer nach Sibirien müssen, dann brauchen die da ja auch Kölsch. Wir hätten ansonsten doch persönliche Freunde verloren. Und unsere Gäste wollten wir nicht auch noch Berlin überlassen.“
Und so eröffnen sie im September 1997 als Vorhut des Politzirkus‘ ihr Lokal am Berliner Schiffbauerdamm. Von manchen Bonnern nun als „Verräter“ beschimpft, bläst Drautzburg auch in Berlin der Wind zunächst heftig ins Gesicht: Die nicht zimperliche Berliner Boulevardpresse stürzt sich auf den „Bremser aus Bonn“, und als er mit Grunert im Umzugsjahr 1999 in der Reinhardstraße noch ein Weinlokal eröffnet, werfen Unbekannte alle Scheiben ein und besprühen die Fassade mit einem Graffiti: „Bonner verpisst Euch“. Zehn Jahre später sind solche Animositäten passé. Es kommt nur gelegentlich noch vor, dass ein Berliner Drautzburg ungläubig darauf hinweist, dass die von ihm so ausgeschilderten „Rheinterrassen“ vor der Ständigen Vertretung an der Spree liegen, dass folglich wohl ein Irrtum vorliegen müsse.
Editha Limbach ist 1998 aus dem Bundestag ausgeschieden. Sie lebt mit ihrem Ehemann in ihrem Haus in Bonn-Lengsdorf. Als sie gegen Ende ihrer letzten Legislaturperiode eines Tages mit ihrem Berliner Abgeordnetenkollegen Gero Pfennig (CDU) aus dem „Langen Eugen“ auf den Rhein schaut, sagt Limbach, die nicht mit dem Bundestag nach Berlin gehen möchte: „Aber den Rhein, den habt ihr in Berlin nicht.“ Pfennig antwortet: „Wenn wir ihn hätten, wäre der in Berlin auf jeden Fall viel größer.“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Bonn.. Das Heft können Sie hier bestellen.