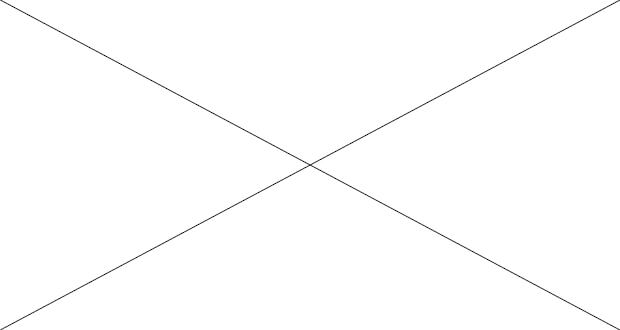Wer verhandeln will, muss mit Schlafentzug leben können. Muss lange sitzen können und akzeptieren, dass manchmal sogar die Zeit zum Stillstand kommt: So hielt der Verhandlungsleiter der Uno-Klimakonferenz im Jahr 2007 auf Bali kurz vor Mitternacht einfach die Uhr an, weil die Gespräche zu scheitern drohten und die für die Konferenz vorgesehene Zeit auslief; ein beliebter Trick, nicht nur auf internationalen Konferenzen. Auf Bali verhandelten die versammelten Politiker bis zum frühen Morgen weiter – und einigten sich schließlich.
Das Verhandeln bis in die Nacht ist nichts Ungewöhnliches bei politischen Konferenzen oder in Tarifkonflikten. So entscheiden nicht allein Sachkenntnis und rhetorisches Geschick über Erfolg oder Misserfolg: Die physische Konstitution kann am Ende ausschlaggebend sein. Denn wer erschöpft ist, ist eher bereit zu Zugeständnissen.
Verhandeln – wird die Begabung dazu schon in die Wiege gelegt? Oder ist es eine Fertigkeit, die Politiker sich ohne weiteres aneignen können? Begabung muss sein, die Techniken sind aber durchaus erlernbar. In Deutschland wird nur nicht allzu viel Wert darauf gelegt, sie zu vermitteln. In Schule und Uni werden angehende Politiker kaum auf den späteren Alltag vorbereitet. Dabei ist Politik doch ein ständiges Verhandeln – in Ausschüssen, Kommissionen und Gremien. „Wir brauchen eine stärkere Professionalisierung“, sagt der Heidelberger Politikwissenschaftler Frank R. Pfetsch. Pfetsch hat sich als Professor intensiv mit dem Verhandeln in der Politik befasst und mit Studenten regelmäßig in Simulationen politische Prozesse durchgespielt; zum Beispiel den Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union. Dieser praktische Ansatz ist aber ein für Deutschland noch seltenes Beispiel. „In der Diplomatie gehören Verhandlungstechniken zur Ausbildung. In Politik und Wirtschaft eignet man sie sich in der Regel erst im Job an“, sagt Pfetsch. Und er stellt fest: „Deutsche gehen mit großer fachlicher Versiertheit in Verhandlungen – die psychologischen Kenntnisse fehlen aber häufig.“
So ist es kein Wunder, dass die bekannteste Verhandlungsmethode aus den USA kommt, das Harvard-Konzept, das an der berühmten Universität in Massachusetts erfunden wurde. Im fachübergreifenden „Negotiation Project“ erforschen Wissenschaftler dort Methoden des Verhandelns. Die angelsächsischen Staaten sind Vorreiter bei solchen Techniken: Auch die Mediation kommt aus den USA, die gütliche Streitbeilegung mit Hilfe eines Vermittlers. Ihre Wurzeln hat sie in der Bürgerrechtsbewegung, die in den 70er Jahren „Neighborhood-Justice-Center“ erfand, Schlichtungsstellen, die Nachbarschafts-Streitigkeiten aus der Welt schafften – ohne staatliche Hilfe. In internationalen Konflikten ist die Mediation Standard: Das Völkerrecht lebt von Freiwilligkeit – denn eine übergeordnete gerichtliche Autorität, deren Urteile auch politisch durchgesetzt werden könnten, fehlt hier.
Basarverhandeln herrscht vor
„Ich bin manchmal erstaunt, dass sich bewährte Modelle wie das Harvard-Konzept kaum herumgesprochen haben“, sagt die Berliner Rechtsprofessorin Andrea Budde, die in Seminaren der Friedrich-Ebert-Stiftung Abgeordnete, Bürgermeister und andere Mandatsträger schult. „In Deutschland herrscht immer noch das klassische Basarverhandeln vor“, so Budde. Eine Partei stelle ihre Forderung auf, die andere unterbiete sie. Dann gehe es wie in einem Ping-Pong-Spiel hin und her. Dabei sei es erfolgversprechender, nicht bloß in Forderungen zu verhandeln, sondern ein gemeinsames Problem zu definieren. „Davor schrecken viele Politiker aber zurück, weil sie fürchten, das sähe nach Kuschelkurs aus. Sie haben Angst, vor Partei oder Fraktion das Gesicht zu verlieren.“ Kooperatives Verhandeln sei derzeit vor allem in Krisenzeiten gefragt, sagt Budde. Da seien die Parteien einer Verhandlung schneller zur Verständigung bereit, weil der Druck, zu Ergebnissen zu kommen, größer ist. Tatsächlich war das, was die deutsche Politik jetzt in der Finanzkrise erreicht hat, eine Meisterleistung des politischen Verhandelns: Innerhalb von nur einer Woche brachten Regierung, Parlament und Bundesrat ein Gesetz auf den Weg – ein einsamer Rekord.
Es gibt aber Anzeichen dafür, dass man das Verhandeln in Deutschland inzwischen professioneller angeht. So steht die Schulung von Funktionären bei den Parteien heute höher im Kurs als früher. So gründete die SPD im vorigen Jahr ihre Führungsakademie, an der die ausgebildet werden, die in der Partei Verantwortung übernehmen sollen. Geschult wird auch in den Verhandlungstechniken.
Bereits 2001 riefen die Sozialdemokraten ihre Kommunalakademie ins Leben, wo junge Mandatsträger das Know-how für ihre Aufgaben erwerben können. Die anderen Parteien setzen vor allem auf ihre Stiftungen und bieten dort Schulungen an.
Die Blase trainieren
Die Gewerkschaften hingegen sind schon lange ganz vorne dabei, wenn es um Weiterbildung geht: Ob Verdi oder IG Metall, Betriebsräte können sich nicht nur im Betriebsverfassungsrecht und in Wirtschaftsfragen schlau machen: Neben Rhetorik steht immer auch die Verhandlungsführung im Seminarprogramm. Da werden schon einmal Tipps weitergegeben, wie ein Verhandler seine Blase trainieren kann, um möglichst lange am Konferenztisch durchzuhalten.
Die Gewerkschaften sind sich der Bedeutung der Weiterbildung sehr bewusst: versuchen sie doch, Waffengleichheit mit den Arbeitgeber-Vertretern herzustellen, die gewöhnlich über eine akademische Ausbildung verfügen. Die Arbeitnehmer gehen davon aus, dass die Arbeitgeber ihre kommunikativen Fähigkeiten schon zur Genüge trainieren konnten – was in Wirklichkeit nicht ohne weiteres zutrifft.
Verhandlungs-Know-how vermitteln verstärkt auch Hochschulen. So hat die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität vor acht Jahren das Centrum für Verhandlungen und Mediation gegründet. Die Studenten können sich Vorträge etwa des früheren Kohl-Beraters und Sicherheitspolitikers Horst Teltschik anhören, der über „Verhandeln bis zur Einigung“ doziert. Mit neuen Ansätzen tun sich auch die Hochschulen hervor, an denen – ganz im angelsächsischen Trend – „Governance“, die Steuerung politischer Prozesse, gelehrt wird. Zu diesen gehört die private Hertie-School-of-Governance in Berlin. Die Hochschule bietet ihren Studenten Seminare an, bei denen etwa der frühere Staatssekretär im Auswärtigen Amt Jürgen Chrobog weitergibt, was er bei Verhandlungen mit Terroristen oder auf diplomatischem Parkett gelernt hat. Es erscheint jedoch bezeichnend für den Stellenwert der Verhandlungskunst in Deutschland, dass es der Hochschule nicht gelang, einen geeigneten Dozenten zu finden, der eine Professur für Verhandlungstechniken übernimmt. „Der Kandidat hätte über ein hohes Maß an Berufserfahrung verfügen müssen“, sagt Hochschulleiter Michael Zürn. „Doch findet man auf diesem Feld eher jüngere Praktiker, die das unterrichten. Verhandlungstechniken sind eben noch keine etablierte wissenschaftliche Disziplin.“ Zwar gebe es inzwischen eine Vielzahl von Agenturen, die beim Verhandeln berieten, doch trenne sich da „die Spreu vom Weizen“, so Zürn. Die Qualität der Angebote schwanke.
Berater treten auf den Plan
Das ist auch eine Chance: eine Chance für Menschen wie Foad Forghani. Forghani ist ein so genannter Ghost-Negotiator. Er berät bei Verhandlungen – manchmal offen, meistens aber arbeitet er im Verborgenen, eben wie ein Ghost-Writer. Auch der Beruf des Ghost-Negotiators kommt von jenseits des Atlantik. Dort organisiert die Branche sich bereits in Berufsvereinigungen, in Deutschland gibt es bislang eine Hand voll. Forghani arbeitet in der Regel für Unternehmen, nicht selten in politisch brisanten Fällen. Er tritt bei Problemfällen auf den Plan, dann, wenn der Mandant schon mit dem Rücken zu Wand steht. Wenn auch die Anwälte nicht mehr weiterwissen. Ob er ein konkretes Beispiel nennen könnte? Kann er nicht – Berufsgeheimnis! Wie er arbeitet, verrät Forghani dennoch: „Ich analysiere die Situation und stelle mir immer die Frage, was die größten Ängste des Gegners sind. Sie müssen in Erfahrung bringen, was ihm wirklich Schmerzen bereitet – und wie man zugleich eine Brücke bauen kann, um seine Interessen wahrzunehmen.“
Herausfinden könne er das unter anderem anhand von Mimik und Gesten des Gegenübers – psychologische Kenntnisse sind das A und O. Ein Ghost-Negotiator versucht alles, um die Schlacht zu Gunsten des Mandanten zu entscheiden. Das ist auch der Grund, warum sie eine dunkle Nische besetzen und kaum die Öffentlichkeit suchen. Dem Gegner Schmerzen bereiten – damit ist schlecht Werbung zu machen; doch ein verzweifelter Verhandlungsführer greift auch nach dem letzten Strohhalm, wenn Ansehen, Job oder Unternehmen gefährdet sind. „In Verhandlungen arbeiten viele meiner Mandanten mit Argumenten, weil sie glauben, es gehe in einem Streit um die Wahrheit“, sagt Forghani. Darum gehe es aber gar nicht. Es gehe nur darum, die Entscheidung der Gegenseite zu beeinflussen. Diese Erkenntnis lassen Unternehmen sich gerne 30.000 bis 50.000 Euro kosten – das und zuweilen noch mehr verdient ein Ghost-Negotiator pro Auftrag.
Bei Verhandlungen gehe es immer um die Ausübung von Macht und um Einfluss, sagt Forghani. Darum sei ein guter Politiker letztlich nichts anderes als ein guter Verhandler: „Gute Politiker verhandeln, schlechte führen Kriege“.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Verhandeln – Die vernachlässigte Kunst. Das Heft können Sie hier bestellen.