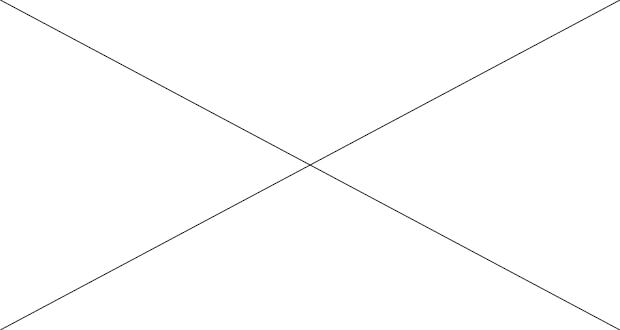Im Juni kam wieder einmal ein warmer Regen auf die Unterstützer des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney nieder: Sheldon Adelson, Inhaber einer internationalen Kasino-Kette, öffnete seinen Geldspeicher und steckte zehn Millionen Dollar in die Sammelbüchse des „Super-Pacs“ namens „Restore our Future“. Die Vereinigung ist ein – zumindest offiziell – von Romneys Kampagne unabhängiges politisches Komitee. Durch TV-Spots und Anzeigen wirbt sie für die Politik des Kandidaten.
Spender Sheldon gilt als der achtreichste Mensch in den USA, er unterstützte schon George W. Bush im Wahlkampf. Der Milliardär besitzt auch eine Tageszeitung in Israel, die recht eindeutig die Politik von Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützt; Sheldon hatte sich mit der Israelpolitik von US-Präsident Barack Obama unzufrieden gezeigt und soll sich zum Austausch über das Thema bereits mit Romney getroffen haben.
Die Nähe zum „Big Business“
Angesichts der Summen, die Romney-Anhänger seit dessen faktischem Sieg in den republikanischen Vorwahlen einwerben, bekommen einige Demokraten inzwischen Bauchschmerzen: Zwar steuert auch die Obama-Kampagne wieder auf Rekordeinnahmen zu, doch sind die Republikaner wegen ihrer Nähe zum „Big Business“ besonders stark darin, Spenden von großen Unternehmen einzuwerben. Und diese wickeln sie über die „Super-Pacs“ ab, die keinen Limits unterliegen, was die Höhe der Zuwendung anbelangt.
Die Rolle der Super-Pacs, der „Super Political Action Commitees“, sorgt im amerikanischen Wahlkampf für Diskussionsstoff. Im Jahr 2010 hatte das höchste Gericht der USA, der Supreme Court, entschieden, dass es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung nicht vereinbar sei, wenn Unternehmen und andere juristische Personen keine Wahlkampfspenden tätigen dürften – das war die bis dato geltende Regelung. Seit dem Urteil ist es den Super-Pacs jedoch erlaubt, bei Milliardären wie Sheldon auf Fischzug zu gehen, einzige Voraussetzung: Sie selbst müssen organisatorisch unabhängig von der offiziellen Kampagne sein. Obama kritisierte den Richterspruch seinerzeit umgehend, und zwar deutlich: „Dieses Urteil öffnet die Schleusen für den politischen Einfluss großer Unternehmen, auch solcher, die aus dem Ausland gelenkt werden.“ Das ist zwei Jahre her, und inzwischen hat der Präsident es sich anders überlegt: Zu Beginn dieses Jahres versandte sein Kampagnenmanager Jim Messina eine Mail an alle Unterstützer, man müsse den rechtlichen Realitäten Rechnung tragen und gebe Super-Pacs, die der demokratischen Partei nahestehen, nun den Segen. Die Schlacht war eröffnet.
In diesen Tagen aber ergreift Obamas Widersacher aus dem Jahr 2008 öffentlich das Wort, der republikanische Ex-Kandidat John McCain: Sheldons Kasinogruppe operiere global, und auf diesem Wege fließe ausländisches Geld in amerikanische Kampagnen. Daher sei das keine gute Sache mit den Super-Pacs. Und McCain gab auch noch seinem Parteifreund Romney einen mit: „Wir müssen den Einfluss des Geldes auf die Politik verringern und uns klar machen, dass Unternehmen keine Menschen sind.“ Das zielte auf eine Bemerkung Romneys gegenüber einem Zwischenrufer bei einer Rede im vorigen Jahr ab: „Unternehmen sind Menschen, mein Freund“, sagte der Politiker, was vermutlich nicht ganz wörtlich gemeint war.
In Washington gibt es neben McCain auch Andere, die die Entwicklung mit Sorge betrachten. „Ich habe kein Problem mit den Super-Pacs an sich“, sagt Sheila Krumholz, Leiterin des Center for Responsive Politics, das sich für Transparenz in der Politik einsetzt. „Es geht darum, dass wir seit der Supreme-Court-Entscheidung nicht mehr die ganze Futterkette nachvollziehen können.“ Früher gab es nämlich nur Einzelpersonen als Spender, und die durften einem Kandidaten – wie auch heute noch – maximal 5000 Dollar zukommen lassen. Vor den Vorwahlen sind Spenden von maximal 2500 Dollar pro Person erlaubt, dieselbe Summe noch einmal vor der eigentlichen Wahl. Wer die Spender sind, muss die Kampagnenorganisation der Wahlkommission melden.
Trick: Gesellschaft gründen
Die heutigen Super-Pacs allerdings dürfen Spenden eben in unbegrenzter Höhe einsammeln – was sie zwar auch der Wahlkommission melden müssen. Krumholz warnt jedoch, es sei ein Leichtes, zum Zweck des Polit-Sponsorings eine Gesellschaft zu gründen, die selbst nicht den Berichtspflichten der Super-Pacs unterliege. Diese könne dann an einen Super-Pac spenden, und so wäre nur nachvollziehbar, wer der Spender sei – nicht aber ohne weiteres, wer hinter dem Spender stehe.
Und die ganz besondere Waffe in den Händen der Unterstützerkomitees sind spezielle Wohlfahrtsorganisationen, die den Super-Pacs in die Hände spielen: So hat Karl Rove, der frühere Berater von George W. Bush, den republikanischen Super-Pac „American Crossroads“ gegründet. Dieser nimmt in TV-Spots und Internetvideos den Präsidenten aufs Korn und hält ihm etwa widersprüchliche Aussagen zur Gesundheitsreform vor. Zugleich gründete Rove aber auch „American Crossroads GPS“, eine gemeinnützige Organisation, die sich selbst als Graswurzelorganiation bezeichnet und Menschen dabei helfen will, sich in öffentlichen Angelegenheiten zu engagieren. Crossroads GPS ist daher kein politisches Komitee und schon gar kein Super-Pac, und daher unterliegt es nicht deren Rechenschaftspflichten. Der Witz dabei: Crossroads GPS darf an Crossroads spenden. Zweifellos ist das nichts, was nur den Republikanern vorzuhalten wäre, die demokratischen Super-Pacs machen es inzwischen genauso, und nun also mit dem Segen des Präsidenten.
Fördert Geld die Demokratie?
Und so können beide Seiten ein Argument ins Feld führen, das Arthur J. Hackney, Vizepräsident der amerikanischen Vereinigung der Politikberater und Dienstleister für Crossroads, im Gespräch mit p&k nennt: „Mit dem Geld, das die Super-Pacs für Spots einsetzen, dienen sie der Information der Leute und damit der Demokratie.“ Dass die Spots oft recht boshafte Negativspots sind, lässt Hackney nicht gelten. „Wir würden Obama nicht als schlechten Menschen darstellen, denn das ist er nicht“, sagt der Berater. „Wir gleichen nur ab, was er in Reden sagt und was er am Ende tut.“
Und Transparenz-Kämpferin Sheila Krumholz kann dem Spendenstrom tatsächlich auch einen positiven Aspekt abgewinnen: „Man muss durchaus feststellen, dass der demokratische Wettbewerb durch das viele Geld teils sogar gefördert wurde. Newt Gingrich und Rick Santorum hätten im republikanischen Vorwahlkampf vermutlich nicht so lange durchgehalten, wenn sie nicht durch Super-Pacs gestützt worden wären.“
Hauptstreitpunkt bleibt also die Frage der Transparenz. Die Demokraten im Kongress sind jedenfalls nicht lange nach dem Supeme-Court-Urteil mit einem Gesetzentwurf zu einem „Disclosure Act“, einem Transparenzgesetz, an der republikanischen Mehrheit gescheitert – auch, wenn sie diese immerhin in ein so genanntes Filibuster trieben, eine dieser endlosen Redeschlachten im Plenum bis zur totalen Erschöpfung. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Gesetz in naher Zukunft erlassen wird“, meint John Wonderlich, politischer Direktor bei der Transparenzinitiative Sunlight Foundation: „Obama interessiert sich nicht wirklich dafür, die Republikaner sind offen dagegen, und die Demokraten haben keine Mehrheit im Kongress.“ Es besteht jedoch Hoffnung, dass sich ganz am Ende doch etwas bewegt: Ob es nun die Entscheidungen zur Sklaverei oder den Bürgerrechten waren, der Supreme Court ist irgendwann immer der gesellschaftlichen Mehrheitsmeinung gefolgt.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Follow me – Das Lobbying der Sozialen Netzwerke. Das Heft können Sie hier bestellen.