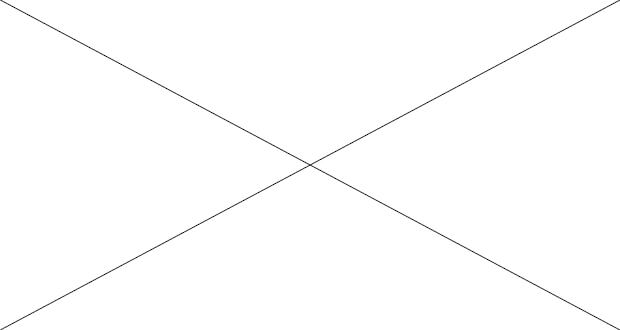p&k: Herr de Maizière, bei den innerdeutschen Gesprächen über den Einheitsvertrag waren Sie als DDR-Ministerpräsident zunächst dabei, haben dann aber Günther Krause weiterverhandeln lassen. Warum?
Lothar de Maizière: Bei der ersten Verhandlung saß Wolfgang Schäuble auf der anderen Seite, ich verhandelte für die DDR. Und bei allem, was wir dabei besprachen, sagte er immer: Ja, in Ordnung, das könne er sich vorstellen – vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskanzlers. Da hatte er sich immer so eine Hintertür offen gelassen. Also habe ich Krause in der Mittagspause gesagt: Jetzt verhandelst du, und zwar auch immer vorbehaltlich der Zustimmung deines Ministerpräsidenten.
Was wurde in großer Runde verhandelt und was in kleineren?
Es gab so viele tausend Einzelheiten zu klären, da mussten wir Verhandlungen auf Ministeriumsebene führen. Und das, was dort nicht gelöst werden konnte, das wurde dann an die zentrale Verhandlungsrunde delegiert. Die größten Brocken. Und die waren dann in der Rohskizze des Vertrags in eckige Klammern gesetzt. Diese eckigen Klammern aufzulösen, darin zeigt sich nachher das wahre Verhandlungsgeschick. Und das geht dann nach dem Schema: Tust du mir einen großen Gefallen, tue ich dir zwei kleine Gefallen.
Wer liefert denn den Rohentwurf?
Beim ersten Entwurf des Vertrags zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion kam die Rohskizze von der bundesdeutschen Seite. Und da haben wir gemerkt, dass es sehr schwierig ist, von einem Vertragskonzept etwas wegzuverhandeln, was einem gar nicht passt. Es steht ja erst einmal da und hat eine faktische Kraft. Daher haben wir gesagt, dass die Rohskizze beim zweiten Vertrag, beim eigentlichen Einigungsvertrag, von unserer Seite kommt. Zwischen dem ersten Staatsvertrag und dem Einheitsvertrag hatte sich ja auch die Lage verändert: Die CDU hatte in Niedersachsen die Mehrheit verloren, womit ihre Bundesratsmehrheit weg war. Um nachher nicht am Bundesrat zu scheitern, haben wir also die Länder an den Vertragsverhandlungen beteiligt. Und da kam für die SPD-geführten Länder Wolfgang Clement, damals Chef der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen, und für die schwarzen Länder kam der bayerische Finanzminister Georg Freiherr von Waldenfels. Die beiden waren unterschiedlich gefärbt, aber in der Verfolgung ihrer föderalen und regionalen Interessen einig. Das waren im Grunde die schwierigsten Brocken.
Wie hat sich das ausgewirkt?
Ich wollte vertraglich geregelt haben, dass die ostdeutschen Länder in Fragen, die nur oder überwiegend sie betreffen, eine Sperrminorität im Bundesrat haben. Das war aber völlig unmöglich. Clement hat im Einigungsvertrag durchgesetzt, dass Nordrhein-Westfalen künftig nicht mehr sechs, sondern sieben Stimmen hat. Ich war besorgt um den Erhalt der ostdeutschen Kulturgüter. Wenn da von heute auf morgen die Länder für zuständig gewesen wären, wäre das den Bach runter gegangen. Ich wollte den Bund zur Kofinanzierung der Kultur in den ostdeutschen Ländern verpflichten. Da bekamen die Westländer Angst, dass der Zentralstaat sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Es gab zudem auch Überlegungen, wieviele Länder es in Ostdeutschland geben sollte. Oskar Lafontaine schlug einen Nord- und einen Südstaat vor – das rechne sich besser. Ich habe damals gesagt, dass dieser Vorschlag besonders beherzigenswert ist, weil er aus dem Saarland kommt.
Es gab zunächst die Verhandlungen innerhalb von Deutschland, dann die Zwei-Plus-Vier-Verhandlungen mit den Alliierten. Welche waren denn die schwierigeren?
Die schwierigeren waren die deutsch-deutschen Verhandlungen, weil es viel mehr Details zu regeln gab. Andererseits waren die von der Atmosphäre nicht so schwierig, denn beide Seiten wollten die Einigung. Es ging nur um die Regelung der Details, und es ergab sich eine besondere Schwierigkeit daraus, dass wir besser über den Westen Bescheid wussten als der Westen über uns. Der Westen hat sich nicht so sehr für die DDR interessiert.
Wolfgang Clement soll darauf bestanden haben, dass Bonn Regierungssitz bleibt.
In unserem Entwurf war es Berlin. Und da sagte er: Wenn Sie das im Vertrag durchsetzen, dann kriegen Sie im Bundesrat von Nordrhein-Westfalen und von Bayern keine Zustimmung zum Einheitsvertrag. Dann gehen Sie ungeregelt in die Deutsche Einheit. Das war ja auch der Vorschlag von Oskar Lafontaine. Der fragte: wozu ein Vertrag? Er meinte, es reiche ein schlankes Überleitungsgesetz, das der Bundestag beschließt. Da habe ich gesagt: Herr Clement, wenn Sie das so durchsetzen wollen, dann gilt ab dem nächsten Tag der horizontale Länderfinanzausgleich. Da meinte er: Wieso, wir haben doch den Fonds Deutsche Einheit? Ja, sagte ich, der Fonds Deutsche Einheit ist aber verfassungswidrig, solange die DDR nicht beigetreten ist. Und in dem Moment, in dem die DDR beigetreten ist, gilt das Grundgesetz in der vorliegenden Fassung. Das fand er nicht so toll. Aber ich will ihn hier nicht als den großen Verhinderer darstellen. Er hat eben die Interessen seines Bundeslands vertreten, das mit 16 Millionen Einwohnern das größte Bundesland überhaupt ist.
War die westdeutsche Seite dominant bei den Verhandlungen?
Die westdeutsche Seite war sicherlich insofern dominant, als dass sie über mehr Ressourcen, mehr ausgebildete Beamte verfügte – und außerdem lebten sie in dem Bewusstsein: Wir kommen aus dem erfolgreichen System, und ihr seid gerade gescheitert. Ihr müsst alles so machen, wie wir es machen wollen. Hinterher wird das schon irgendwie so gehen. Das war das Schwierigste: denen beizubringen, dass eine bedingungslose Übernahme all dessen, was in der Bundesrepublik 40 Jahre gewachsen war, an der Wirklichkeit von 40 Jahren DDR vorbeigegangen wäre.
Auch bei den Zwei-Plus-Vier-Verhandlungen wurden in kürzester Zeit Fragen geklärt, die über Jahrzehnte erhebliches Konfliktpotenzial hatten. War das eine diplomatische Meisterleistung?
Ja, aber aber man muss auch sagen: Die Zeit war reif. Dass es so schnell gehen würde, war uns jedoch nicht klar.
Sie gingen in diese Verhandlungen und wussten noch gar nicht, wann überhaupt was passieren würde?
Die Sowjets wollten, dass die Gespräche Vier-Plus-Zwei heißen. Und da haben die beiden deutschen Staaten gesagt: Nein, sie müssen Zwei-Plus-Vier heißen. Denn die beiden deutschen Staaten beschlossen in Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ihre Einigung und beteiligen die vier Siegermächte daran. Das hieß im Klartext: Ob wir uns einigen, lassen wir nicht mehr von Euch entscheiden, sondern nur noch wie. Das hatte auch mit dem gesteigerten Selbstbewusstsein der Ostdeutschen zu tun. Wir hatten die Mauer zu Fall und eine friedliche Revolution zustande gebracht. Das wollten wir uns nicht mehr nehmen lassen. Ich glaube, dass da den Sowjets klar wurde: Die Zeit ist abgelaufen.
Bei den Zwei-Plus-Vier-Verhandlungen gab es ja angeblich bis zum Schluss so starke Kontroversen, dass die Verhandlungen immer wieder auf der Kippe standen.
Ja, es gab Kontroversen. Nur mit den Amerikanern gab es so gut wie keine. Die hatten auch am wenigsten zu verlieren, obendrein hofften sie, einen starken Partner in Deutschland zu finden. François Mitterand hatte anfangs Bedenken, und England, Frau Thatcher, hatte große Befürchtungen, dass Deutschland Hegemonialbestrebungen an den Tag legen könnte. Die Engländer und Franzosen waren damals aufgrund ihrer Vormachtstellung über Deutschland und wegen ihres Vetos im UN-Sicherheitsrat Großmächte. Mit der deutschen Einigung verloren sie diese Vormachtstellung an Deutschland und wurden zu Mittelmächten. Das tangierte das Selbstbewusstsein.
Wie war das Klima in den Zwei-Plus-Vier-Verhandlungen?
Es schwankte. Hans-Dietrich Genscher konnte sehr gut mit den Amerikanern, auch mit Schewardnadse. Ich persönlich konnte mit Schewardnadse am besten. Wahrscheinlich auch wegen der nicht unähnlichen Sozialisation in einem sozialistischen Staat. Ich konnte auch mit Roland Dumas sehr gut, während Douglas Hurd für meinen Geschmack einfach zu kühl und zu britisch war. Aber nachher war allen klar: Wir schließen den Vertrag, der die Nachkriegsordnung beendet. Es war auch allen klar, dass der Vertrag die Voraussetzung für ein sich einigendes Europa war.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Politiker des Jahres – Peer Steinbrück. Das Heft können Sie hier bestellen.