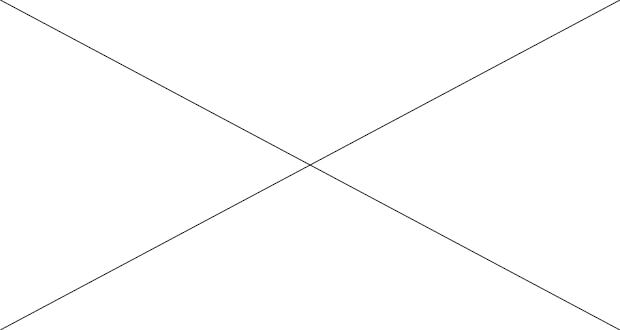Max Weber ist der Kronzeuge. Immer wieder wird der vor fast 90 Jahren verstorbene Soziologe herangezogen, wenn es um die Frage geht, was denn eigentlich zum Politiker qualifiziert. Gerne wird dann das „langsame Bohren harter Bretter“ zitiert, zu dem laut Webers Essay „Politik als Beruf“ bereit sein müsse, wer Politiker werden will. Wer diesen Beruf ergreife, müsse ein „Führer“, gar ein „Held“ sein, schreibt Weber. Auf jeden Fall habe der Politiker sich zu „wappnen mit jener Festigkeit des Herzens, die auch dem Scheitern aller Hoffnungen gewachsen ist“. Nach einem leichten Job klingt das nicht gerade. Und das ist der Beruf tatsächlich nicht, denn er bringt extreme Belastungen mit sich – die jedoch durch das Gefühl von Bedeutung, durch Einfluss und so manches Privileg gelindert werden. Wie aber lebt und arbeitet er, der Politiker an sich?
Sein Privatleben
Am Mittwochmorgen nach der Bundestagswahl im Berliner Café Einstein: Die Noch-Abgeordnete Grietje Staffelt ist hier zu Gesprächen verabredet. Die 34-jährige Grüne kommt noch einmal zu einem der Treffpunkte, an denen sich in Berlin Politiker, Lobbyisten und Journalisten treffen. Es dürfte eines der letzten Male sein, denn Staffelt verlässt die Bundespolitik. Im Jahr 2000 zog sie als Nachrückerin in den Bundestag ein, doch hat sie in diesem Jahr nicht mehr kandidiert. Beim Betreten des Raums entdeckt sie Renate Künast und Jürgen Trittin, die gemeinsam frühstücken und vermutlich beraten, wie es nach der Wahl weitergehen soll mit den Grünen im Bundestag. „Da sind ja meine Chefs“, sagt Staffelt – und korrigiert sich: „meine Ex-Chefs“.
Bei einem Caffè Latte sagt sie dann: „Es ist Zeit, wieder ins normale Leben zurückzukehren.“ „Normales Leben“, das bedeutet, dass sie sich mehr ihrer einjährigen Tochter widmet und eine Doktorarbeit schreibt, über „E-Learning“ in Medienunternehmen. Politik und Familie miteinander zu vereinbaren, erforderte für die Politikerin ein straffes Management und war zuweilen eine aufreibende Angelegenheit. Die kleine Tochter war zuletzt immer dabei, wenn Staffelt vom Wahlkreis Flensburg-Schleswig mit der Bahn nach Berlin fuhr. „Um nach Berlin zu kommen, musste ich zweimal umsteigen“, sagt sie. „Mit Kind ist das ziemlich umständlich.“
Staffelts Töchterchen Ann-Luisa erblickte nach dem Licht der Welt schnell auch das Licht der Öffentlichkeit: Denn sie wurde als Kind von zwei Politikern geboren und kurz nach der Geburt vom Berliner Boulevardblatt „B.Z.“ mit Foto als „Baby Rot-Grün“ vorgestellt. Grietje Staffelt ist nämlich mit Ditmar Staffelt verheiratet, der bis vor kurzem für die SPD Berlin-Neukölln im Bundestag saß.
„Das Leben in der Politik war ein Leben unter ständiger Hochspannung“, sagt Grietje Staffelt. „Auch im Urlaub musste ich immer erreichbar sein, denn es hätte ja womöglich ein Amoklauf passieren können.“ Staffelt war medienpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und damit auch die Expertin, die gegebenenfalls zu Computer-Killerspielen etwas sagen musste. Sich entziehen: kaum möglich. Der parlamentarische Geschäftsführer hat die Handynummern all seiner Fraktionskollegen.
Je mehr Erfahrung sie als Abgeordnete sammelte, desto mehr lernte sie, Prioritäten zu setzen: „In den ersten vier Jahren habe ich noch gearbeitet wie ein Wolf und so ziemlich jeden Termin wahrgenommen.“ Manche Geburtstage von Freunden und Familienmitgliedern habe sie versäumt; später wurde sie gelassener.
Nun ist vorerst Schluss mit der Politik, für beide Abgeordnete Staffelt. Ditmar Staffelt legte sein Mandat bereits im Januar nieder, weil er als Lobbyist zum Luft- und Raumfahrtkonzern EADS ging. Womöglich können die beiden jetzt das erhoffte „normale Leben“ führen.
Seine Gesundheit
Horst Seehofer verschleppte vor sieben Jahren eine Grippe und erlitt eine lebensbedrohende Herzmuskelentzündung. Auch Wolfgang Bosbach verschleppte eine Herzmuskelentzündung, mit bleibenden Schäden. Peter Struck hatte einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall, Matthias Platzeck erlitt einen Hörsturz. Menschen in anderen Berufen werden ebenfalls krank, auch andere leiden unter Stress – doch der Sog der Politik ist so stark, dass viele sogar nach gesundheitlichen Warnschüssen nicht davon lassen können. Matthias Platzeck immerhin zog vor drei Jahren die Konsequenzen und verzichtete auf den SPD-Parteivorsitz – als hätte er geahnt, wie stressig die Aufgabe noch werden kann.
„Viele Politiker zeigen zu wenig Fürsorge für sich selbst“, sagt Bundestagsärztin Barbara Vonneguth-Günther. „Gerne überhören sie die Signale des eigenen Körpers, weil sie meinen, sie müssten immer funktionieren.“ Die Ärztin arbeitet direkt im Reichstagsgebäude und behandelt die Abgeordneten in den Sitzungswochen. Wenn sie die Volksvertreter in ihrer Praxis empfängt, öffnet sich für diese für kurze Zeit ein geschützter Bereich, in dem sie sich auch einmal leidend und schwach zeigen dürfen. „In der Praxis können sie Patient sein und Sorgen ansprechen“, sagt Vonneguth-Günther. Doch sobald sie diesen geschützten Bereich wieder verlassen, gilt es, sich möglichst nichts anmerken zu lassen.
Häufig litten die Patienten unter Bluthochdruck, Schlafstörungen und unter Atemwegsbeschwerden, wegen der Klimaanlagen in Flugzeugen und Zügen. Gerade der Bluthochdruck sei bezeichnend, sagt die Ärztin: Verdeutliche er doch den psychischen Druck, unter dem die Politiker stehen würden. Vonneguth-Günther ist auch gelernte Psychotherapeutin und weiß, dass man die Seele nicht getrennt vom Körper betrachten darf; und da so ein Politiker nicht selten Anfeindungen ausgesetzt ist, muss er manches verarbeiten.
Da kann es passieren, dass der Zahnarzt während der Behandlung über die Gesundheitsreform diskutieren will, wie einer erzählt.
Besonders belastend sind die Zeiten des Wahlkampfs, mehr vielleicht noch die Zeit, in der sie parteiintern um Listenplätze und Wahlkreise kämpfen. „Vor der Sommerpause und besonders nach dem Wahlkampf waren viele sehr erschöpft und müde“, sagt Vonneguth-Günther – die Mühe des Sich-Behauptens in Partei und Fraktion werde aber durch die große Aufmerksamkeit, die Politiker erfahren, und den Einfluss, den sie haben, wieder aufgewogen. Das verstärke die Tendenz, immer weiterzumachen, womöglich trotz Krankheit. „Das kann zu einem Teufelskreis werden, wenn jemand nicht mehr kann“, sagt die Ärztin.
Der andauernde Strom von zu verarbeitenden Informationen ist eine Herausforderung. „Ein Autoverkäufer kann abends nach Hause gehen“, sagt Thomas Kliche, Experte für politische Psychologie, „bei Politikern hingegen löst sich das Privatleben fast auf.“ Es sei wichtig, dass sie einen privaten Ausgleich jenseits der Politik hätten. „Es ist immer gut, wenn jemand Kinder hat.“ Dann habe der Mensch noch eine andere Lebensrolle als die des Politkers, nämlich die des Vaters oder der Mutter. Wenn der private Halt fehlt, keine Familie oder Kinder da sind, sei der Sog der Politik viel stärker.
Um sich davor zu schützen, dass die Politik ihn völlig vereinnahmt, müsse ein Politiker sich vor allem seine Integrität bewahren, sagt Kliche. „Integrität ist ein unglaublich wichtiger Schutz. Wenn man sich zu sehr auf Lobbyinteressen einlässt, kann man vor sich selbst nicht bestehen.“
Sein Geld
Ein Politiker würde sich niemals trauen, das zu sagen, was Peter Glotz 2002 in der „Zeit“ schrieb: „Politiker müssen viel besser bezahlt werden.“ Eine unpopuläre Forderung ist das, die der 2005 verstorbene ehemalige SPD-Bundesgeschäftsführer erhob, einer der wenigen Intellektuellen, die es längere Zeit in der Politik aushielten. Einem Bundestagsabgeordneten, so Glotz in dem Beitrag, sei „nur zu gut bekannt, dass noch die vierte Reihe bei den großen Aktiengesellschaften besser bezahlt wird“. Doch wie viel bekommt so ein MdB eigentlich? Im Monat 7668 Euro, steuerpflichtig. Dazu kommt die steuerfreie Pauschale in Höhe von 3868 Euro, mit der vor allem die Kosten für das Abgeordnetenbüro zu bestreiten sind. Eine Summe von maximal 14.712 Euro darf ein Parlamentarier für die Bezahlung seiner Mitarbeiter ausgeben.
Für den Abgeordneten selbst gibt es also zirka 92.000 Euro brutto im Jahr, was wahrlich nicht schlecht ist – doch verdient schon mancher junge Rechtsanwalt in einer Großkanzlei mehr. Warum gilt dann bloß immer noch die landläufige Meinung, Politiker seien überbezahlt?
„Die Privilegien sind das Problem“, sagt Karl Heinz Däke, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Die Bezahlung der Abgeordneten an sich sei angemessen, meint der Mann, der allen Vertretern des Staates so kritisch auf die Finger schaut. Doch sei schon die steuerfreie Aufwendungspauschale ungerecht: „Hier ist keine Gleichbehandlung gegeben. So muss sich zum Beispiel ein Abgeordneter aus Berlin keine Zweitwohnung nehmen, weil sein Wahlkreis in der Hauptstadt ist.“ Auch dass ein Parlamentarier nach zwei Legislaturperioden schon einen Pensionsanspruch von 1682 Euro hat, ohne eigene Beiträge zur Altersversorgung geleistet zu haben, findet Däke nicht in Ordnung. Er plädiert dafür, das nordrhein-westfälische Modell der Abgeordnetenvergütung auf den Bund zu übertragen. Der Landtag in Düsseldorf beschloss vor vier Jahren, die Diäten der Abgeordneten nahezu zu verdoppeln – dafür entfielen aber sämtliche steuerfreien Pauschalen, auch die Alterversorgung tragen die Parlamentarier jetzt durch Zahlungen in ein Versorgungswerk selbst.
Die Chancen für einen Systemwechsel im Bund stehen nach dem Wahlsieg von Schwarz-Gelb nicht schlecht: Die FDP plädiert schon seit langem dafür, die Abgeordneten nicht wie Beamte, sondern wie Mitglieder freier Berufe zu behandeln.
Sein Ansehen
Als Willy Brandt noch Kanzler war, war das Ansehen der Politiker in Westdeutschland so groß wie nie zuvor und wie niemals mehr danach – das besagt die Erhebung zum Ansehen von Berufen, die das Allensbach-Institut alle ein bis drei Jahre durchführt. Im Jahr 1972 zählten 27 Prozent der Befragten den Beruf des Politikers zu denen, vor welchen sie am meisten Achtung haben. Von großem Ansehen kann man da trotzdem kaum sprechen, bewegen sich doch zum Beispiel die Ärzte in Bereichen von 70 bis 80 Prozent – kontinuierlich, bis heute. Bei den seit 1991 für Gesamtdeutschland durchgeführten Befragungen sind Politiker inzwischen auf 6 Prozent zurückgefallen, das besagt die letzte Befragung vom Januar 2008. Aus welchen Gründen auch immer: Nur die Buchhändler haben mit 5 Prozent ein noch geringeres Ansehen als die Politiker.
Vielleicht sind es die nicht eingehaltenen Wahlversprechen, vielleicht die verschleiernde Sprache, die den Bürgern ihre Volksvertreter verleidet. Vielleicht tragen die Medien einen Teil dazu bei. „Für uns Journalisten ist es einfach, draufzuhauen“, sagt Robin Mishra, Leiter des Hauptstadtbüros der Wochenzeitung „Rheinischer Merkur“. „Angesichts der Privilegien, die Politiker haben, schüren einige Medien zuweilen Sozialneid.“ Mishra gehört zu den Journalisten, die sich vorgenommen haben, zu einem differenzierten Bild der Volksvertreter beizutragen: „Wie ich lernte, die Politiker zu lieben“ lautet der Titel seines im Februar erschienenen Buchs, in dem er der Frage nachgeht, wo es im Verhältnis zwischen dem Volk und seinen Vertretern hapert. Um künftig den Dauerwahlkampf wegen der vielen Wahltermine im Land zu vermeiden, schlägt der Journalist vor, Wahltermine zusammenzulegen; gegen die erwähnten Privilegien helfe eine Reform der Abgeordnetenbezahlung nach Vorbild des Düsseldorfer Landtags. Mishra ist nicht der einzige Hauptstadtjournalist, der eine Lanze für die Politiker bricht: Auch Nikolaus Blome, Leiter des Hauptstadtbüros der „Bild-Zeitung“, nahm sich ihrer an, mit einer im vorigen Jahr erschienenen Streitschrift: „Faul, korrupt und machtbesessen? Warum Politiker besser sind als ihr Ruf“. Vielleicht also geht da noch was im Verhältnis zwischen Politik und Medien. Und vielleicht verbessert sich das Ansehen der Politiker bei der nächsten Allensbach-Studie: „Die Finanzkrise hat gezeigt, dass der Staat noch zu gebrauchen ist“, meint Robin Mishra.
Sein Millieu
Zumindest auf Bundesebene sind die meisten Politiker Akademiker: In der jetzt beendeten 16. Wahlperiode hatten die Juristen die Mehrheit im Hohen Haus: Fast jeder vierte Abgeordnete hatte Jura studiert, nämlich über 23 Prozent. Dann kamen, fast schon abgeschlagen, die Gymnasiallehrer mit 5,5 und die studierten Politologen mit 4,6 Prozent. Es folgten die Volkswirte, Ingenieure, Verwaltungsfachleute, Sozialarbeiter, Betriebswirte und einige andere akademische Berufe – Handwerker und Kaufleute waren zahlenmäßig schwach vertreten. Ein Hinweis darauf, dass die politische Klasse für die Gesellschaft nicht so repräsentativ ist, wie sie sein sollte? Der Darmstädter Soziologe Michael Hartmann hat sich einmal nicht die Abgeordneten, sondern die Zusammensetzung der deutschen Bundesregierungen angeschaut – und er hat festgestellt: „Es gibt einen Trend zur Verbürgerlichung. Seit Ende der 90er Jahre finden Sie in den Kabinetten deutlich mehr Bürger- als Arbeiterkinder.“ Während das Verhältnis zwischen diesen in der alten Bundesrepublik meist 60 zu 40 gewesen sei, habe es im ersten Kabinett von Angela Merkel bereits bei 65 zu 35 gelegen. „Deutschland nähert sich immer mehr anderen Ländern an“, sagt der Professor. „In den meisten großen europäischen Staaten gilt die Regel, dass bis zu drei Viertel der Regierungsmitglieder aus bürgerlichen oder großbürgerlichen Verhältnissen kommen.“ Dass sich das in Deutschland ändert, hängt für ihn mit dem schwindenden Einfluss der Parteien zusammen. Diese hätten früher noch ein bestimmtes Millieu repräsentiert – und Vertreter eben dieses Millieus, die sich in der Ochsentour hochgedient hatten, in die Parlamente geschickt. „Heute fehlt es an Personal, und daher sind Blitzkarrieren wie die von Ursula von der Leyen oder Karl-Theodor zu Guttenberg leichter.“ Medienwirksames Auftreten spiele eine größere Rolle. „Dass Kurt Beck sich voriges Jahr vom Parteivorsitz zurückgezogen hat, war nicht überraschend“, sagt Hartmann. „Für die großstädtischen Medienvertreter war er der Bauer vom Lande. Wie sie mit ihm umgegangen sind, das hätte sich bei Otto Schily niemand getraut.“ Kurt Beck – Auslaufmodell des Ochsentour-Politikers? Aufsteigertypen wie Gerhard Schröder, solche, die sich bis ganz nach oben kämpfen, werde es immer seltener geben, sagt der Soziologe.
Vielleicht aber muss der Politiker auch schlicht die nötigen Nehmerqualitäten haben, um sich hochzukämpfen. Als Kurt Beck wieder daheim in Rheinland-Pfalz war, schimpfte er beim SPD-Landesparteitag über die Genossen in Berlin, die den „Umgang eines Wolfsrudels“ pflegen würden. Das sei eine „Umgangsform von vorgestern“, die es zu überwinden gelte. Lange vor vorgestern, im Jahr 1919, gab Max Weber dazu einen Rat: „Nur wer sicher ist, dass er daran nicht zerbricht, wenn die Welt, von seinem Standpunkt aus gesehen, zu dumm oder zu gemein ist für das, was er ihr bieten will, dass er all dem gegenüber: ,dennoch!‘ zu sagen vermag, nur der hat den Beruf zur Politik.“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Politiker – wie sie leben und arbeiten. Das Heft können Sie hier bestellen.