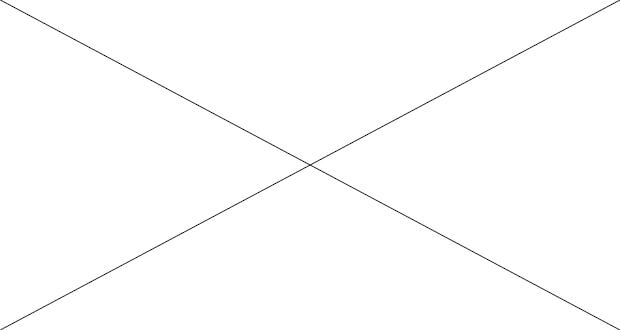p&K: Herr Bölling, welche Botschaft muss eine Regierung in Krisenzeiten vermitteln?
Klaus Bölling: In einer Krisensituation wie der heutigen muss die Regierung jedenfalls den Verdacht vermeiden, dass sie triste Wirklichkeiten verdeckt oder schönt. Sie ist – um Rudolf Augstein zu zitieren – den Wählern gegenüber verpflichtet, „zu sagen, was ist“. Sie ist aber nicht genötigt, die düsteren Wirtschaftsprognosen für bare Münze zu nehmen.
Angenommen, die Regierung wäre im Besitz einer bislang unbekannten, besonders düsteren Wirtschaftsprognose: Wäre es legitim, diese erst einmal zurückzuhalten?
Nein. Die Verschuldung der Bundesrepublik Deutschland war niemals so gewaltig wie jetzt. Das heißt: Wer, beispielsweise, heute dem Wählervolk sagt, er wolle trotz dieser ernsten Lage die Steuern senken, der bemogelt das Volk. Dafür gibt es auf lange Zeit keinen Spielraum – da muss die Regierung ehrlich sein.
Im vergangenen Oktober hat sich die Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister vor die Presse gestellt und verkündet, die Spareinlagen seien sicher. War das das richtige Signal?
Ich meine: ja. Die Deutschen sind ein in der Regel diszipliniertes Volk. Es drohte aber bei den Sparern die Gefahr einer Panik. Die ist durch diese Erklärung abgewendet worden. Dass die Aussage keinen Ewigkeitswert haben werde, darauf ist von Kritikern hingewiesen worden. Aber eine Beruhigung der Sparer war politisch und psychologisch richtig.
Was hätten Sie als Regierungssprecher in der jetzigen Situation gemacht?
Es gilt der alte Merksatz: Man muss nicht alles sagen, was wahr ist. Aber alles, was man sagt, muss wahr sein. Und das zweite Sprichwort: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Ich würde jeder Kanzlerin und jedem Kanzler dringend davon abraten, den Regierungssprecher mit der Losung in die Bundespressekonferenz zu entsenden: „Es ist doch alles gar nicht so schlimm.“ Er darf aber auch nicht den Eindruck erwecken, als würden die apokalyptischen Reiter schon ins Kanzleramt galoppieren. Er muss schlicht bei der Wahrheit bleiben. Er darf die Dramatik der Krise nicht bagatellisieren, er soll aber auch nicht übertreiben, rhetorisch noch mal eins draufsatteln. Das Gefährlichste ist die Schönrednerei. Es steht ja nicht nur die Kredibilität der Herren Wilhelm und Steg auf dem Spiel, die beide sehr fähige und sachverständige Leute sind. Es steht die Glaubwürdigkeit der ganzen Regierung auf dem Spiel. Wenn es richtig ist, dass die politische Klasse seit Jahr und Tag an Glaubwürdigkeit verliert, wäre es eine bloße Torheit, den Regierungssprecher die Realität leugnen oder verharmlosen zu lassen.
Das würde zudem die Journalisten provozieren, gezielt nachzufragen.
Selbstverständlich. Die Presse hat ein Wächteramt, auch wenn sie nicht als vierte Gewalt im Grundgesetz festgeschrieben ist. Allerdings: Zum Wächter der Exekutive und des Parlaments braucht es Sachverstand. Es kann Kritik an der Regierung notwendig sein, aber dann müssen die Kommentatoren auf der Höhe der Kenntnisse der Regierung sein. Die Regierung wird immer bedenken, wie diese oder jene Entscheidung auf die Wähler wirken wird. Es ist eine Schwäche der Demokratie, dass auf Stimmungen Rücksicht genommen wird. Ich beobachte einige Kolumnisten, die sich als Präzeptoren der Regierung aufspielen. Dabei reden sie die ganze Klasse der Politiker schlecht, werfen diesen Inkonsequenz und fehlenden Mut vor. Das sind die Alles-Besserwisser.
Gab es die nicht schon immer?
Nein, nicht in diesem Maße. Bei einem leider nicht so kleinen Kreis von Journalisten – vor allem im riesigen Pressekorps in Berlin – beobachte ich einen höchst akuten Bildungsnotstand. Michel Friedmann bezeichnete Politiker neulich in seiner Kolumne für eine Boulevardzeitung durch die Bank als „diese Typen“. Das halte ich für gefährlich. Mit dem Verächtlich-Machen von Politikern haben wir sehr schlechte Erfahrungen in der ersten deutschen Republik gemacht. Damals haben nicht nur rechte Blätter die Republik mies gemacht, sondern auch linke – und nicht nur die Zeitungen der KPD. Davor warne ich.
Würden Sie mit den heutigen Regierungssprechern tauschen wollen?
Ich bin nicht so eingebildet, dass ich sagen würde: „Das reizt mich noch. Ich könnte das viel besser.“ Die Sachverhalte sind an manchen Tagen noch komplizierter als zu meiner Zeit. Ich sage an manchen Tagen, denn die Herausforderung der Demokratie durch die Rote-Armee-Fraktion war für Helmut Schmidt, sein Kabinett und auch für mich eine ganz besondere Herausforderung. Dass ich sie nach Meinung des Bonner Pressekorps gemeistert habe, bedeutet für mich auch nach so langer Zeit noch eine Genugtuung. Ich habe sehr viel Respekt vor Ulrich Wilhelm und Thomas Steg. Manchmal versetze ich mich in einem Gedankenspiel in die Bundespressekonferenz und überlege, was ich auf die Fragen antworten würde. Manchmal hätte ich eine gute Antwort, selten eine bessere. Ich bewundere die beiden Herren dafür, wie schnell sie eine Antwort geben. Es werden ja in dieser Krise harte und gute Fragen gestellt, die man nicht aus dem Stegreif beantworten kann.
Der Medienbetrieb in Berlin hat sich stark gewandelt, er ist durch das Internet viel schneller geworden. Wirkt sich das auf die Qualität des Journalismus aus?
Ja. Ich möchte nicht als Miesepeter erscheinen, doch gibt es ein bestimmtes Segment des Pressekorps, das ständig nach News lechzt und den Ehrgeiz hat, schneller zu sein – nicht unbedingt besser. Das stimmt mich sehr besorgt. Wir erleben den Anfang einer Krise der Printmedien. Wir haben eine Krise der Werbewirtschaft bei den Zeitungen. In den USA sind Zeitungen bereits eingegangen. So dramatisch ist es bei uns noch nicht. Die Diskussion, dass wir eines Tages kaum noch Zeitungen haben werden, muss aber sehr ernst genommen werden. Die Information im Internet ist zwar schnell, sie kann aber nicht mit gründlichen Analysen einer seriösen Zeitung konkurrieren. Wenn die Leute nur noch auf Fernsehen und Internet angewiesen sind, glaube ich nicht, dass sie das mitbringen, was den Wähler im Idealfall dazu befähigt, über das Schicksal unserer Demokratie mit zu entscheiden.
Zuweilen wird beklagt, die Bundespressekonferenz habe an Bedeutung verloren.
Ich bin dort ja nicht mehr präsent. Doch auch auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen: Das Bonner Pressekorps fragte vor dem Hintergrund einer soliden politischen Bildung. Heute haben offenbar einige jüngere Journalisten – vorwiegend wohl vom privaten Fernsehen – schon gar keine Ahnung mehr, wie unser Grundgesetz entstanden ist. Sie wissen auch nichts mehr über Adenauer. Sie wissen schlicht zu wenig. Im Bonner Pressekorps gab es kaum jemanden, der nicht mit der Geschichte der Weimarer Republik und des so genannten Dritten Reichs vertraut war. Über die letzten Jahre habe ich selbst erlebt, dass junge Journalisten, die mich zum Thema RAF befragt haben, häufig keine Ahnung hatten.
Als Regierungssprecher arbeitet man viel und unter hohem Druck – geht man da an die Grenze seiner Belastbarkeit?
Bitte missverstehen sie das nicht als Wichtigtuerei: Meine Arbeitstage waren mindestens so lang wie die des Bundeskanzlers – manchmal länger, manchmal natürlich auch kürzer. Das bleibt nicht im Anzug stecken, man bezahlt für diese Tätigkeit einen Preis. Ich habe damals einen Hörsturz bekommen. Der Arzt sagte mir damals, dass ihn das überhaupt nicht wundere. Der Beruf bedeutet eben Stress. Doch bleibt immer der Unterschied, dass die letztendliche Entscheidung der Kanzler zu treffen hat. Ein Regierungssprecher wird zu allen Zeiten nur so gut sein, wie sein Verhältnis zum Regierungschef eng ist. Es gab in der Vergangenheit Regierungssprecher, die nicht in den inneren Zirkel des Kanzlers vorgestoßen sind.
Sie gehörten zum sogenannten Kleeblatt, dem engsten Zirkel um Helmut Schmidt …
… von dem Schmidt sagte, dass er sich in keinem Gremium wohler gefühlt habe. Er konnte sagen, was er dachte, ohne auch nur die kleinste Indiskretion fürchten zu müssen. Ich hatte das Glück, dass ich schon ein Vertrauensverhältnis zu Helmut Schmidt hatte, als er selbst noch gar nicht daran denken konnte, Bundeskanzler zu werden. Heute haben wir ein freundschaftliches Verhältnis, wobei immer noch gilt: „Keep your distance.“ Ein bisschen Distanz ist ihm erwünscht – und meiner Erziehung nach finde ich das auch gut.
Sie sind im vergangenen Jahr nicht nur 80 Jahre alt geworden, Sie wurden auch für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Wie ist Ihr Verhältnis zur Partei?
Da möchte ich Helmut Schmidt sinngemäß zitieren: Wer zu 100 Prozent mit seiner Partei einverstanden ist, der ist ein Dummkopf. Wer zu 60 Prozent mit der Partei einverstanden ist, ist ein kritischer Kopf. Wer sich aber öfter fragt, wie lange er das alles noch aushält, ist wohl falsch in der Partei. Ich bin nie ein so genannter Parteisoldat gewesen. Ich bin der Meinung, die Fähigkeit zum kritischen Urteil – auch über die eigene Partei – hängt nicht davon ab, ob man ein Gesangbuch der evangelischen oder katholischen Kirche oder eben ein Parteibuch in der Schublade hat. Das ist vielmehr eine Frage der Persönlichkeit des Einzelnen. Ich habe in der ARD genug Leute erlebt, die nur dank ihres Parteibuchs Karriere gemacht haben – pures Mittelmaß. Ich räume ein: Die öffentlich bekannte Parteizugehörigkeit kann den Verdacht wecken, über andere Parteien stets einseitig zu urteilen.
Sie waren Regierungssprecher zur Zeit des „Deutschen Herbst“. Wie sind Sie mit dem Wissen umgegangen, dass von dem, was Sie sagen, schlimmstenfalls Menschenleben abhängen konnten?
Es gab eine sehr bedenkliche Situation: Nach der Entführung von Peter Lorenz haben Helmut Kohl und der Berliner Bürgermeister Schütz darauf gedrungen, dass wir die Terroristen des 2. Juni, die in Berlin einsaßen, freilassen. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und der Berliner Bürgermeister meinten, das wären wir Lorenz schuldig. Helmut Schmidt war damals schon dagegen, dass wir nachgeben. Dann ist aber so entschieden worden. Die Terroristen waren schon auf dem Weg in den Jemen, als mich der Chefredakteur des Norddeutschen Rundfunks während eines Live-Interviews fragte: „Bedeutet die Entscheidung, die Leute ziehen zu lassen, dass der Staat den Anspruch aufgibt, sie später strafrechtlich zu verfolgen?“ Ich habe – ein bisschen naiv – gesagt: „Natürlich nicht.“ Helmut Kohl hatte das im Radio gehört und wollte sofort den Kanzler sprechen. Der war aber nicht erreichbar. Also hat sich Kohl mit Manfred Schüler, dem Chef des Bundeskanzleramts, verbinden lassen und gesagt: „Wenn mein Freund Peter Lorenz jetzt tot aufgefunden werden sollte, dann trägt der Regierungssprecher die Verantwortung dafür.“ Ich war so kaputt, dass Schüler mir gesagt hat, ich solle erst einmal nach Hause fahren und ausschlafen.
Wurden Sie infolgedessen vorsichtiger?
Nein. Ich erinnerte mich daran, was Gustav Heinemann mir gesagt hatte, als er mir meine Ernennungsurkunde überreichte: Dass ich „schonend“ mit der Wahrheit umgehen solle. Es gab in der RAF-Zeit Tage, an denen man nur ganz wenige Stunden Schlaf hatte. Im Zustand der Übermüdung kann man nicht nur Autounfälle anrichten, sondern auch in der Politik das Falsche sagen. Diese Gefahr war mir immer gegenwärtig.
Bei der Landshut- und Schleyer-Entführung haben sie eine Nachrichtensperre verhängt. Würde so etwas heute noch funktionieren?
Nein, ganz klar. Der Konkurrenzdruck hat so dramatisch zugenommen, dass genug Journalisten so handeln würden wie damals die Tageszeitung „Die Welt“. Eine Nachricht über die Entsendung der GSG-9, die ein israelischer Amateurfunker abgefangen hatte, wollten sie auf der ersten Seite bringen. Der Bundeskanzler und ich haben dort angerufen und den Redakteuren gesagt, dass sie den Erfolg unserer Bemühungen riskieren. Heute würde es eine solche Rücksichtnahme wohl nicht mehr geben. Das Wort Nachrichtensperre hat sich eingebürgert, und ich möchte das heute nicht mehr abstreiten. Ich habe damals ganz einfach für das Argument geworben, dass jede vorzeitige Information den Erfolg der Fahndung nach den Entführern von Hanns-Martin Schleyer zunichte machen könne. Dafür hat fast jeder Verständnis gehabt. Es gab aber auch jüngere Kollegen, die gesagt haben: „Lieber Bölling – einmal machen wir das, aber das nächste Mal nicht mehr.“ Der Markt ist heute härter und brutaler. Die Zahl derer, die nicht wirklich urteilsfähig sind und nur auf Geschwindigkeit Wert legen, ist erheblich gestiegen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Wahlkampf – Diesen Sommer in Ganz Deutschland. Das Heft können Sie hier bestellen.