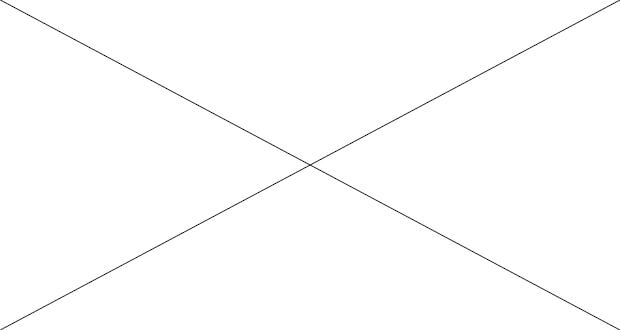Im Berliner Büro der CSU-Abgeordneten Dorothee Bär steht auf dem Tisch eine langstielige Lilie, die einen dezenten Duft verströmt. An der Wand hängt ein Bild der Tochter – und eins der Abgeordneten mit Microsoft-Gründer Bill Gates. Wer hier mit der Politikerin sprechen möchte, muss mit dem Vorzimmer einen Termin vereinbaren, und zwar möglichst für die Sitzungswoche, dann zur gegebenen Zeit zum Jakob-Kaiser-Haus fahren, am Pförtner vorbei und an der Büroleiterin – eigentlich. Eigentlich aber ist der Aufwand auch nicht nötig, denn es gibt einen schnelleren Weg: den über Facebook. Dort kommentiert Bär in Echtzeit Plenumsdebatten und lässt ihre Fans wissen, dass „der unsägliche Siggi Pop am Mikro gerade durchdreht“ oder dass „Merkel supergut drauf“ sei.
Wie hoch der Erkenntnisgewinn dabei auch immer sein mag: Bärs Fans mögen das, zumal die Abgeordnete aus Bamberg im Netz aktiv mitdiskutiert, was nicht jeder ihrer Kollegen tut. Und wenn im Sozialen Netzwerk zwar der Blumenduft fehlt und das Bild der Tochter, so eröffnet die Politikerin doch einen direkten Zugang. Einen so direkten, dass ein Parteifreund sie schon fragte, ob sie die Leute nicht zu dicht an sich heranlasse. Jo mei – die CSU ist halt eine konservative Partei.
Potenzial erkannt
Den Direktkontakt, den Facebook, Twitter und Co. ermöglichen, gab es vor nur fünf Jahren noch nicht. In dieser kurzen Zeitspanne hat das Web 2.0 den politischen Diskurs massiv verändert, wenn nicht revolutioniert. Es hat Resonanzräume geschaffen, in denen mitunter „Stürme entstehen“, wie Peter Kruse sagt, einer der Vordenker der deutschsprachigen Web-Community. Der Professor und Inhaber einer Beratungsfirma meint damit, dass sich Diskussionen in Blogs und Sozialen Netzwerken binnen kürzester Zeit hochschaukeln und handfeste Folgen im „echten Leben“ haben können – etwa, wenn über 130.000 Menschen eine Online-Petition gegen Netzsperren unterzeichnen, mit der sich dann der Bundestag befassen muss.
Frei nach der Marxschen Formel, nach der das Sein das Bewusstsein bestimmt, hat die neue Technik eine neue Idee hervorgerufen, der besonders „Digital Natives“, also mit dem Internet aufgewachsene Nutzer, anhängen: die Idee einer freien Netz-Gesellschaft, in der alle einen offenen Diskurs führen, in der sich Gleichgesinnte nach Belieben zusammenschließen und gemeinsam für ihre Ziele kämpfen können – ob es sich um die Wahl von Joachim Gauck zum Bundespräsidenten handelt oder bloß das von Spaßvögeln in Facebook propagierte Ziel, den TV-Schuldnerberater Peter Zwegat nach Griechenland zu schicken.
Parteien und Politiker nutzen das Internet seit über zehn Jahren zur politischen Kommunikation, wenn auch nicht immer so interaktiv, wie mancher Anhänger sich das wünscht. Seit dem Präsidentschafts-Wahlkampf von Barack Obama vor zwei Jahren spricht die Politszene gerne von dessen vorbildlichem Graswurzel-Wahlkampf im Netz und von den Communitys, die es zu pflegen und zu mobilisieren gelte. Obamas Ansatz, Unterstützer mit digitalen „Tools“ aktiv am Wahlkampf zu beteiligen, wurde in Fachkreisen zwar schon bis zum Geht-nicht-mehr diskutiert; doch bei allem zwischenzeitlichen Hype ist das Potenzial des Web 2.0 als Mittel der politischen Kommunikation heute unbestritten.
Lobbyist als Reputationsmanager
Und daher bemühen sich inzwischen auch Interessenvertreter, es für ihre Zwecke zu nutzen: So propagiert Gunnar Bender, Lobbyist beim Mobilfunkunternehmen E-Plus, eine onlinegestützte Form von Public Affairs: „Digital Public Affairs“ nennt er, was bislang eher unter dem Schlagwort „E-Lobbying“ lief. Bender und seine Kollegen in der E-Plus-Hauptstadtrepräsentanz gehen seit April im Netz in die Vollen: Sie bespielen unter dem Namen „UdL-Digital“ einen Blog, eine Facebook-Seite, einen Youtube- und einen Twitter-Kanal; die Abkürzung steht für Unter den Linden, wo sich der Sitz der Repräsentanz befindet.
Bender, der schon die FDP im Bundestagswahlkampf beraten und mit Freshfields-Anwalt Lutz Reulecke einen Lobbyisten-Ratgeber verfasst hat, umreißt seinen Ansatz beim Gespräch in den Räumen der in einem gediegenen Altbau gelegenen Repräsentanz so: „Wir machen unseren Job an der Schnittstelle zwischen klassischem Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit.“ Der digitale Lobbyist betreibe vor allem Agendasetting, er sei ein „Wahrnehmungs- oder Reputationsmanager“ – also jemand, der eine Botschaft in den Resonanzraum des Web einspeist und hofft, dass daraus vielleicht ein Sturm im Sinne von Peter Kruse entsteht. Oder wenigstens eine steife Brise.
So erscheint es passend, dass E-Plus für seinen neuen Lobby-Ansatz eigens einen Blogger eingestellt hat, der den Auftritt in den Sozialen Netzwerken pflegt: Sachar Kriwoj heißt der und hat zuvor als Pressesprecher bei einer Online-Lernplattform gearbeitet – das politische Geschäft allerdings ist neu für ihn. Ein Lobbyist, der keiner ist? Bender sagt, er mache „lieber einen Blogger zum Lobbyisten als umgekehrt“. Denn, und da wird er dann grundsätzlich: Social Media sei „eine Geisteshaltung“.
Wenn aber die Kommunikationsform in den Vordergrund rückt, tritt der Inhalt womöglich zurück, und es stellt sich die Frage, ob ein so verstandener digitaler Lobbyismus nicht vor allem PR unter einem trendigen Namen ist. „Die Abgrenzung zwischen Public Affairs und PR ist ohnehin nie trennscharf“, sagt der Politikwissenschaftler Christoph Bieber, der den Blog „Internet und Politik“ schreibt. „Bei digitalen Public Affairs handelt es sich nicht selten um eine zeitgemäße Variante dessen, was früher entlang des Begriffs Corporate Social Responsibility diskutiert wurde“, sagt Bieber. Entscheidend für die politische Effektivität des Lobbyings im Netz sei, dass es dem Unternehmen gelinge, die richtige Zielgruppe für seine Themen zu mobilisieren. Für einen Mobilfunkanbieter wie E-Plus käme es demnach darauf an, da anzusetzen, wo seine Interessen sich mit denen von Verbrauchern decken. Gunnar Bender verweist darauf, dass E-Plus sich für mehr Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt einsetze, was auch im Interesse der Verbraucher sei. Ob diese sich aber tatsächlich vor den Karren eines Mobilfunkkonzerns spannen lassen?
Politiker haben Respekt
„In den USA ist es schon seit 20 Jahren üblich, dass Großunternehmen Kunden und Mitarbeiter mobilisieren, zum Beispiel für Volksabstimmungen“, sagt der auf Public Affairs spezialisierte Politikwissenschaftler Marco Althaus. „Warum sollten europäische Unternehmen nicht auch Netzwerke aufbauen und Stimmen für E-Petitionen sammeln?“ Lobbying im Netz müsse nicht bloß eine „nette Dialog-Geschichte“ sein, meint Althaus: „Politiker haben enormen Respekt vor Organisationsfähigkeit.“ Denn wenn sie nicht mehr nur ein Lobbyist im feinen Anzug bedränge, sondern 100.000 Wähler, so würde sie das sehr wohl veranlassen, Positionen noch einmal zu überdenken. So wie es im vorigen Jahr geschah, als der Bundestag Bekanntschaft mit den Paintball-Spielern machte. Damals kippten die deutschen Paintballspieler ein von den Regierungsfraktionen geplantes Verbot der Sportart, indem sie binnen kurzer Zeit eine schlagkräftige Kampagne starteten.
Dass Online-Lobbying tatsächlich Tausende von Menschen mobilisieren kann, und das häufig sogar ohne den organisatorischen Unterbau eines Unternehmens oder Verbands, das demonstrieren täglich Kampagnennetzwerke wie Move-On oder Avaaz. Bei diesen handelt es sich um Nichtregierungsorganisationen (NGOs) neuen Typs: Move-On ist quasi die Mutter derartiger Netzwerke, eine 1998 gegründete US-Organisation, die keine 20 Mitarbeiter hat und online für die Unterstützung progressiver Politik wirbt. Ihre Mittel sind Petitionen, Anzeigen und per Youtube verbreitete Videos. Avaaz ist internationaler aufgestellt und kämpft vor allem für Menschenrechte und Klimaschutz. Der deutsche Vertreter der Organisation hat – na, wo wohl – sein Handwerk in der Wahlkampagne von Barack Obama gelernt.
Julius van de Laar ist selbständiger Kampagnenberater und erst 28 Jahre alt. Trotzdem ist er schon ziemlich gefragt, seit er als „Obamas deutscher Wahlkämpfer“ mediale Aufmerksamkeit erlangte. Er leitete 2007 und 2008 den Jugendwahlkampf des damaligen Senators und verinnerlichte dessen Strategien. Nun stellt er sein Wissen in den Dienst des Avaaz-Netzwerks, dessen Name vom persischen und Hindi-Wort für „Stimme“ kommt. Beim Treffen in einem Berliner Café verrät der großgewachsene ehemalige Basketballprofi, wie es Avaaz gelingen konnte, sechseinhalb Millionen Menschen als Mitglieder zu gewinnen.
„Avaaz ist eher ein Schnellboot als ein großer Tanker“, sagt van de Laar. „Dennoch können wir mit unserem Mail-Verteiler in Deutschland in nur wenigen Stunden 465.000 Unterstützer mobilisieren.“ Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im vorigen Herbst zögerte, ob sie persönlich zum Klimagipfel nach Kopenhagen reisen solle, bombardierten die Aktivisten sie mit personalisierten E-Mails. Merkel hatte aber auch vorher schon Bekanntschaft mit Avaaz gemacht: Demonstranten mit grünen Helmen „begleiteten“ sie auf ihrer Wahlkampf-Zugreise durch Deutschland. Avaaz stellte online die Daten der Reise zur Verfügung und erreichte über das Netzwerk, dass bei jedem Halt Grünhelme Merkel an ihre Klimaversprechen erinnerten. Die NGO gab den Anstoß, und die dezentral zerstreuten Aktivisten organisierten sich daraufhin selbst. Sozialwissenschaftler bezeichnen das als „Empowerment“: Die Aktivisten werden in die Lage versetzt, in Eigenregie etwas zu unternehmen.
Mit Kritik klarkommen
Attraktiv an einer solchen Organisation ist für die Aktivisten vor allem, dass sie niemandem eine langfristige Bindung abverlangt. Sich bei Avaaz zu engagieren, bedeutet nicht, Mitglied in einem Verein zu werden. „Es gibt unterschiedliche Stufen des Engagements“, sagt van de Laar, „die niedrigste ist, eine Petition zu unterschreiben, das ist eine Sache von drei Minuten“. Spenden oder Demonstrationen vor Ort wären die nächsten Stufen.
Die Unverbindlichkeit einer Online-Community hat jedoch auch ihren Preis: den Verlust von Kontrolle, denn die modernen Netzwerke kennen keine Kader. Moderne Online-Kampagnen leben von einer Botschaft, die so stark ist, dass der Sturm im Netzwerk sie bereitwillig weiterträgt. „Message matters“, die Botschaft zählt, das ist denn auch das Credo, das van de Laar aus dem US-Wahlkampf mitgebracht hat. Obamas „Yes, we can“ war eine solche Botschaft. Die Botschaft ist manchmal aber auch die Person selbst, wie der Hoffnungsträger Joachim Gauck. Von der Zugkraft dieser Kampagnen dürften Unternehmenslobbyisten, die Communitys für sich gewinnen wollen, aber nur träumen: Die Fallhöhe von den idealistischen Botschaften Obamas („Hope“) oder dem Aufruf zur Rettung des Weltklimas hinunter zur Freiheit des Mobilfunkwettbewerbs ist groß. Immerhin: Ein Zeichen der Offenheit ist die Entscheidung für Lobbying in den Weiten des Web 2.0 schon. Politikwissenschaftler Althaus attestiert E-Plus-Mann Bender denn auch Mut: „Sein Public-Affairs-Ansatz dürfte ihn im eigenen Haus Überzeugungskraft gekostet haben.“ Denn wer seine Themen von den Internetnutzern offen diskutieren lässt, muss mit Kritik umgehen können; wenn die Kommunikation zum Dialog wird, funktionieren klassische PR-Strategien nicht mehr. Die Unterdrückung kritischer Kommentare kommt in Blogs und bei Facebook gar nicht gut an.
Digitaler Lobbyismus – ein Schritt hin zu mehr Transparenz? Christian Humborg, der Geschäftsführer von Transparency International in Deutschland, ist skeptisch: „Wirklich transparent wäre es, wenn Lobbyisten ihre gesamte Arbeit online dokumentieren würden.“ Wenn sie lückenlos ihre Finanzierung im Netz darlegen und sämtliche Positionspapiere online stellen würden, dann könne sich die Öffentlichkeit ein Bild machen, sagt Humborg. Für den digitalen Lobbyismus sollten dieselben Regeln gelten wie für den Offline-Lobbyismus.
Lobbying auf dem Kunstrasen
Vielleicht birgt die so schnelle und direkte Kommunikation im Netz sogar die Gefahr größerer Intransparenz, des „Astroturfings“: Aus den USA stammt die Strategie, Graswurzelkampagnen vorzutäuschen – der Begriff bezieht sich auf eine Kunstrasenmarke. Beim Astroturfing stellen Unternehmen Webseiten vermeintlicher Bürgerbewegungen ins Netz und lassen gezielt Einträge in Internetforen und Kommentare auf Medienseiten schreiben.
Die Deutsche Bahn erlitt mit solchen Methoden Achsbruch, als der vordergründig unabhängige Think-Tank „Berlinpolis“ für sie tätig wurde und verdeckte PR zu Gunsten einer Bahnprivatisierung betrieb. Im Mai vorigen Jahres deckte die Transparenz-Initiative Lobbycontrol den Schwindel auf.
Dann also lieber gleich beim klassischen Vieraugen-Gespräch bleiben, um Einfluss auf die Politik zu nehmen? Darauf möchte ohnehin kein Lobbyist verzichten, denn wer würde schon ein Gespräch mit der Kanzlerin ablehnen, weil er ja auch an ihre Facebook-Pinnwand schreiben kann? Dass Themen verstärkt über die Öffentlichkeit gespielt werden, ist ein anhaltender Trend der politischen Kommunikation, doch bleibt das Gespräch mit Abgeordneten und Ministerialen die Basis des Lobbyings. Nach einer Studie der internationalen PR-Agentur Edelman unter knapp 400 Abgeordnetenmitarbeitern in Washington, Brüssel, London, Paris und Berlin ist für diese das persönliche Gespräch immer noch der beste Weg, zu kommunizieren: Über 90 Prozent der Befragten bezeichneten es als „effektives Mittel“.
Ungeahnte Kontakte
Zurück ins Büro von Dorothee Bär: Die Abgeordnete nimmt sich Zeit für ein persönliches Gespräch. Ja, sagt sie, die Sozialen Netzwerke seien für sie ein ernstzunehmender Kommunikationskanal geworden: „Hier kann ich mir ein vollständigeres Bild über die Meinungen zu einem Thema verschaffen.“ Auch entstünden Kontakte, die ganz neue Sichtweisen ermöglichten. Ein Anhänger der Grünen aus dem niederrheinischen Kleve habe kürzlich an einer Wanderung teilgenommen, die sie in ihrem bayerischen Wahlkreis veranstaltete – der Kontakt kam über Facebook zustande. Dank der Netzwerke überschneiden sich plötzlich Kreise, die sich sonst niemals überschneiden, eröffnen sich Zugänge, die sonst verschlossen bleiben würden. Also gute Zeiten auch für Lobbyisten? Das Vorzimmer mag sich über Facebook umgehen lassen, und dennoch: „Wer sich im richtigen Leben von Lobbyisten nicht überzeugen lässt, wird sich auch durch Facebook nicht umstimmen lassen“, sagt Bär. Message matters – auf die Botschaft kommt es an.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Lass uns Freunde sein. Das Heft können Sie hier bestellen.