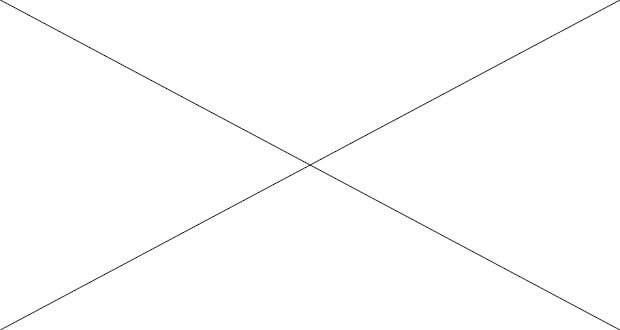p&k: Herr Radon, viele Deutsche haben den US-Wahlkampf mit großer Faszination verfolgt. Wie unterscheidet sich die politische Kultur in Deutschland von der in den USA?
Jenik Radon: Die Kultur ist ganz, ganz anders. Es gibt zum Beispiel zwei Wörter, die ich in Deutschland regelmäßig höre: Sicherheit ist das erste. Wirtschaft, Politik – alles dreht sich um Sicherheit. Das zweite Wort ist Stabilität. Und deshalb macht man hier keine großen Sprünge. In Deutschland sieht man als erstes immer die Risiken: Wenn ich das mache, was könnte dann passieren? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Der Deutsche sieht das Glas immer halb leer. Der Amerikaner sieht es immer halb voll. Und das zeigt sich auch in der Politik: Wir haben in den USA ein präsidentielles System. Dabei spielt Vertrauen eine große Rolle. Hier kann ein Außenseiter von heute auf morgen etwas werden. Das hat nichts mit der Partei zu tun – der kommt rein, der kommt von irgendwo, der kann sich gut verkaufen und hat Erfolg. Das amerikanische Parteiensystem ist nicht so stark ausgeprägt wie die in Europa. Dort muss man sich viel mehr innerhalb der Partei bewähren. Das brauchen wir in den USA überhaupt nicht. Man muss in einer Partei seine Basis haben, aber sonst ist das alles nicht so strukturiert.
Der Wahlkampf in den USA ist viel individualistischer: Die Leute unterstützen einzelne Kandidaten, keine Partei.
Ich habe 1980 Reagan gewählt. 1988 Bush, 1992 Clinton, und seit dieser Zeit wähle ich nur noch Demokraten. Aber ich bin eben auch hin und hergeschwankt, je nach Kandidat. George W. Bush hat vor ein paar Jahren gesagt – und das ist wirklich typisch für ihn –, dass er das Grundsatzprogramm der republikanischen Partei gar nicht gelesen hat. Man macht ja Witze darüber, dass Bush sowieso nicht viel liest – aber es ist wahr: Niemand liest ein Grundsatzprogramm. Das ist unbedeutend.
In einem Interview haben Sie einmal gesagt, Politik in Deutschland sei „boring like hell“. Können die deutschen Politiker vom US-Wahlkampf lernen?
Da kommen wir eben wieder zu der Frage nach der Sicherheit. Der Deutsche will Sicherheit. Im Privatleben, in der Politik, und im Wahlkampf will er entsprechende Botschaften hören. Aber wir brauchen auch Inspiration.
Mit „wir“ meinen Sie die US-Amerikaner?
Nein! Uns! Die Menschen! Wir können doch alle nicht nur hier auf der Welt sein, um zu arbeiten.
Deutschland hat eine sehr nüchterne, sachliche Kanzlerin. Ist das typisch für das Land?
Wir müssen uns doch fragen, wo Deutschland in zehn Jahren stehen wird. Ich sage: Es wird immer noch da sein, wo es jetzt ist, vielleicht wird es wirtschaftlich sogar noch ein bisschen schlechter dastehen, weil die Bevölkerung altert und niemand darauf reagiert. Es wird keine großen Änderungen geben. Ich sehe keine Innovationen. Niemand sagt: Hey, wir haben kaum noch Nobelpreisträger, was machen wir da? Es fehlen die Träume. Wenn man keinen Traum hat, kommt man nicht vorwärts. Meine Mutter, die übrigens Deutsche war, hat meine Träume immer unterstützt. Sie hat gesagt: „Du musst nur hart genug arbeiten, dann gehen sie in Erfüllung.“ Dieses Denken ist in Deutschland verloren gegangen. Man hat hier beinahe Angst vor Träumen und Visionen.
Von Helmut Schmidt gibt es das berühmte Zitat „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“
Okay. Aber Helmut Schmidt hat in Wirklichkeit selbst noch eine Vision gehabt. Man muss sich doch darüber im Klaren sein, was man will. Ich persönlich dachte nach der Wiedervereinigung eigentlich, dass die Einstellung der Deutschen sich endlich ändern würde.
Finden Sie es vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte nicht verständlich, dass man sich hier zu Lande nicht traut, Politiker im Wahlkampf frenetisch zu bejubeln?
Ich habe Leserbriefe in deutschen Zeitungen gelesen, wo es um politische Begeisterung ging. Da hieß es: „Wir haben mit Hitler doch genug davon gehabt.“ Aber man muss doch nicht gleich in Extreme verfallen! Schauen Sie: Welche große NGO hat ihren Sitz in Deutschland? Nur eine. Transparency International. Es gibt hier keine andere. Und das finde ich interessant: Es zeigt, dass die Deutschen immer fragen, was der Staat macht und nicht, was sie selbst machen. In den USA gibt es NGOs wie Sand am Meer. Und was bedeuten NGOs für eine Gesellschaft? Sie bedeuten, dass da jemand nachdenkt: Wie soll es mit der Welt weitergehen? Was kann ich verbessern? Es heißt ja, Barack Obama habe Wahlkampf wie John F. Kennedy gemacht. Und was hat der gesagt? Frage nicht, was dein Land für Dich tun kann – frage, was du für dein Land tun kannst.
200.000 Menschen haben Obama in Berlin zugehört. Können deutsche Politiker diese Sehnsucht nach Visionen nicht aufgreifen?
Es gibt hier zwei Generationen von Politikern. Die ältere kann es für meine Begriffe überhaupt nicht aufgreifen, die versteht das gar nicht. Und die junge Generation ist eher in technischen Fragen begabt. Da muss mehr Bewegung reinkommen. Was ist das Schöne an der Jugend? Die Jugend ist begeistert. Die kann sehr schnell vorwärts kommen, wenn sie muss. Die Jugend versteht vielleicht nicht alles, weil sie nicht die Erfahrung der Alten hat. Aber sie hat die Begeisterung. In Deutschland ist die Begeisterung jedoch sehr gebremst. Das ist in meinen Augen ein riesiger Nachteil. Ich habe in den 90er Jahren in Estland gearbeitet und dort die erste unabhängige Regierung beraten. Der Ministerpräsident war damals 32 Jahre alt. Der Außenminister war 26, der Verteidigungsminister 23.
Hat diese junge Regierung funktioniert?
Ja! Die wussten: Wir haben eine Mission! Sie wussten, in welche Richtung sie wollen. Natürlich muss man immer auch eine Strategie haben. Hier in Deutschland ist leider alles so geordnet. Aber warum sollte man keinen Chef haben, der erst 30 Jahre alt ist? In den USA ist das überhaupt nicht ungewöhnlich.
Die Gegner von Obama haben immer gesagt, er sei zu jung.
Ja ja, wenn man so will, dann war John F. Kennedy auch zu jung, genau wie Bill Clinton …
Wieviel Erfahrung braucht man, um US-Präsident zu werden?
Sehr viel – eigentlich mehr, als ein Mensch überhaupt haben kann. Was am Ende also entscheidet, sind Urteilsvermögen und Charakter.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Verhandeln – Die vernachlässigte Kunst. Das Heft können Sie hier bestellen.