War das eine Klatsche am 14. Oktober in Bayern und am 28. Oktober in Hessen für die “großen” Volksparteien: In beiden Ländern verloren sie jeweils mehr als 10 Prozentpunkte. Der Blick auf die Prozentangaben verdeutlicht erst recht den Einbruch: Die SPD büßte in Bayern mehr als 50 Prozent ein, in Hessen fast 40, die CDU in Hessen mehr als 30, die CSU in Bayern mehr als 20. Und bei den Bundestagswahlen 2017 hatten die beiden großen Parteien jeweils Verluste in Höhe von 20 Prozent hinnehmen müssen. Im Vergleich zu diesen Wahlen sind ihre Anteile innerhalb eines Jahres laut den Meinungsumfragen erneut um 20 Prozent gesunken.
Krise der Parteien
Waren das goldene Zeiten für die Volksparteien in den Siebzigerjahren: Union und Sozialdemokraten holten bei den Bundestagswahlen zusammen über 90 Prozent der Stimmen – bei einer Wahlbeteiligung von mehr als 90 Prozent. Noch bei der Bundestagswahl 2002 entfielen auf die beiden großen Parteien jeweils 38,5 Prozent. Die SPD verfügte Mitte der siebziger Jahre über einen Mitgliederbestand von mehr als einer Million, die CDU von mehr als 800.000. Der Mitgliederschwund der Sozialdemokraten beträgt mehr als die Hälfte, bei der Union knapp die Hälfte.
Das hiesige Parteiensystem war lange ein Hort der Stabilität. Von 1961 bis 1980 gab es im Bund ein Dreiparteiensystem mit der FDP als vielzitiertem Zünglein an der Waage, in den Achtzigerjahren durch die Etablierung der Grünen ein Vierparteiensystem, danach, mit der deutschen Einheit, entstand durch Die Linke ein Fünfparteiensystem. Mittlerweile ist die AfD in allen Landesparlamenten präsent – Deutschland hat ein Sechsparteiensystem. Vielleicht zieht bei den nächsten Bundestagswahlen mit den Freien Wählern eine siebte Fraktion in den Bundestag ein, vielleicht droht ihnen das Schicksal der Piratenpartei, jedenfalls auf Bundesebene. Der Wandel der Union (mehr der CDU als der CSU) zu einer Partei, die kaum noch frühere Positionen aus dem konservativen Lager vertritt, hat das Koordinatensystem verschoben und die SPD geschwächt. Den großen Parteien fehlt der Markenkern. Sie sind in einer Krise. Keiner weiß, wie ihre Zukunft aussieht.
Die Wirklichkeit übertrifft zuweilen die kühnsten Prognosen
Einem Bonmot zufolge sind Prognosen schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Jeder, ob Wissenschaftler oder nicht, kann ein Lied davon singen. Das ist die eine Seite. Die andere: Die Wirklichkeit übertrifft zuweilen die kühnsten Prognosen. So hatte wohl niemand die studentische Revolte in der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre erahnt, kaum einer den plötzlichen Zusammenbruch des Kommunismus Ende der Achtzigerjahre. Insofern mag es angezeigt sein, einige Szenarien, die über den Abgesang auf die Volkparteien hinausgehen, mit Blick auf die politische Kommunikation vorzustellen – ob man sie befürwortet oder nicht. Dabei finden solche Varianten keine Berücksichtigung, die sich auf die digitale Revolution beziehen. Diese kann für die Parteien Fluch und Segen zugleich bedeuten.
Szenario eins: Postdemokratie
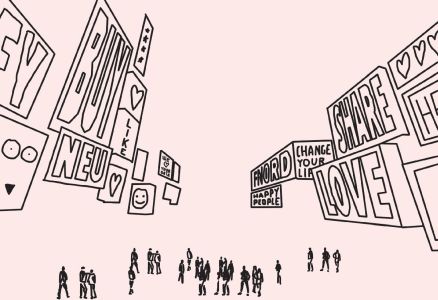
Laut dem französischen Philosophen Jacques Rancière und dem britischen Politikwissenschaftler Colin Crouch haben sich heutige Staaten zu “Postdemokratien” entwickelt, in denen nicht mehr um konkurrierende Konzepte gestritten wird – trotz des Fortbestehens sozialer Klassen. Bürger seien gegenüber dem Einfluss multinationaler Konzerne und ökonomischen Sachzwängen nahezu ohnmächtig, Eliten bestimmten die politische Agenda im “Neoliberalismus”. Mächtige Interessengruppen sind damit wichtiger als Parteien, die kaum noch die Inhalte der Politik prägen. Die politische Kommunikation erlahmt. Oppositionell auftretende Parteien und soziale Bewegungen können sich den Demokratiedefiziten in Grenzen allerdings widersetzen, etwa durch Mobilisierung der Bürger.
Szenario zwei: demokratischer Einparteienstaat

Bereits in der ersten Hälfte der Sechzigerjahre sprach der Politikwissenschaftler Ekkehart Krippendorff vom “Ende des Parteienstaats”. Er sah diesen als das Produkt einer Übergangszeit an. Regierungen ließen sich kaum mehr abwählen, da sie über Instrumentarien der ökonomischen und ideologischen Steuerung verfügten und so vielfältige Wettbewerbsvorteile hätten. Die von Krippendorff konstatierte Entwicklung zum Einparteienstaat gilt im Kern als positiv, sofern innerparteiliche Demokratie praktiziert wird – was viel politisches Engagement erfordert. Mit schwindenden Klassengegensätze verlieren nach Krippendorff Parteien ihre Funktion – es sei denn, eine politische Kraft sage dem ganzen System den Kampf an. Der Autor, Kind seiner Zeit, nahm eine Art Gesetzmäßigkeit wahr: Das Ende des Parteienstaats sei unaufhaltsam. Seinerzeit wurde das Ende des ideologischen Zeitalters beschworen. Die politische Kommunikation betrifft bei diesem Szenario vor allem die Diskussion innerhalb einer Partei.
Szenario drei: Präsidentialisierung
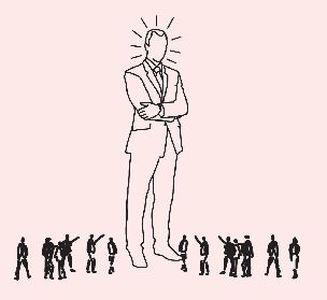
Die im September 2018 von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine ins Leben gerufene überparteiliche linke Sammlungsbewegung mag ein Beispiel für die nachlassende Bindekraft von Parteien sein. Sie hat Vorbilder, wie zum Beispiel die Partei La France insoumise, die der französische Politiker Jean-Luc Mélenchon gegründet hat, um für die Präsidentschaftswahl 2017 zu kandidieren. Oder die britische Momentum-Gruppierung zur Unterstützung des innerparteilich angeschlagenen Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Erfolgreicher als Wagenknecht und Corbyn war Emmanuel Macron mit seiner Sammlungsbewegung En Marche, die ihn 2017 zur Überraschung vieler in den Elysée-Palast geführt hat. Eine gewisse Analogie zu den eben genannten Beispielen nehmen Analytiker in Persönlichkeiten wahr, die sich von ihren Parteien abgenabelt haben und für die Wahlentscheidung eine wichtige Rolle spielen. Hier ließe sich von einer Art Präsidentialisierung des Systems sprechen. Die politische Kommunikation ist in erster Linie von oben nach unten gerichtet. Allerdings kann auch eine charismatische Führungskraft populistische Tendenzen aufgreifen und so verbreitete Stimmungen für sich nutzen.
Szenario vier: Demarchie
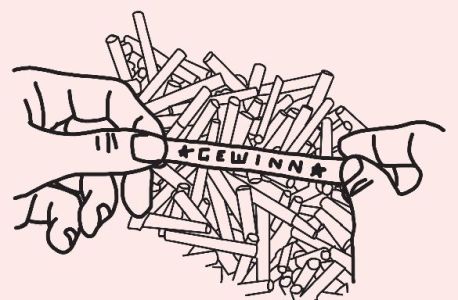
Noch weiter geht jüngst der belgische Publizist und Historiker David Van Reybrouck. Er beklagt Demokratiemüdigkeit und Wahlfetischismus. Die Krise demokratischer Legitimität solle durch das Losverfahren gemildert werden. Wer durch ein Los ins Amt komme, und dafür komme prinzipiell jede Person infrage, könne unabhängig sein, da eine Wiederwahl entfalle. Der Autor strebt vorerst beides an: eine gewählte und eine geloste Kammer. In ferner Zukunft könne das Los die Wahl ganz ablösen. Auch andere Wissenschaftler sehen das Los, das in der Geschichte bereits mehrfach zum Einsatz gekommen ist, unter dem Stichwort „Demarchie“ als politisches Entscheidungsinstrument an. Die Korruptionsanfälligkeit gehe dadurch zurück. Allerdings müsse die politische Kommunikation nicht zum Erliegen kommen, da die Repräsentanten, die ausgelost wurden, auf Inhalte zurückgreifen, über die im Vorfeld Diskussionen entbrennen.
Aufhebung der Parteiendemokratie?
Ungeachtet aller Unterschiede zwischen diesen vier Szenarien gibt es insofern eine Gemeinsamkeit, als in ihnen die Rolle der Wahlen ebenso an Bedeutung verliert wie die der Parteien. Der Terminus “Parteiendemokratie” ist für das jeweilige Modell nicht mehr angemessen. Bei allen Szenarien schwingt eine gewisse Unvermeidlichkeit mit. Aber ist die jeweils genannte Alternative wirklich alternativlos?
Wer heute von der Aufhebung der Parteiendemokratie im dreifachen Hegelschen Sinne spricht, von bewahren, höherführen, beseitigen, kommt nicht um eine präzise Argumentation umhin. Bewahren: Die Parteiendemokratie verdient es, erhalten zu werden, da sie sich bewährt hat und es bisher noch keine angemessene Alternative gibt. Höherführen: Um der Entkernung der Volksparteien keinen Vorschub zu leisten, sind Reformen durchaus sinnvoll, sei es dadurch, dass Mitglieder verstärkt mitbestimmen dürfen, sei es dadurch, dass der Markenkern der Partei erkennbarer wird. Beseitigen: Wer die Parteiendemokratie abschaffen will, hat die Beweislast zu führen, dass der angestrebte Zustand besser sein dürfte als der gegenwärtige. Alternativen müssen auf den Tisch. Dabei verbietet es sich, die hehre Theorie gegen die als krude geltende Praxis auszuspielen.
Allerdings: Was gegenwärtig utopisch sein mag, kann morgen selbstverständliche Realität sein. Endzeitdenken ist nie gut. Vielleicht, ja wahrscheinlich sind Volksparteien im besonderen und Parteien im allgemeinen nicht das Ende der Geschichte, sondern Ausdruck einer bestimmten Epoche, die irgendwann durch eine andere abgelöst wird. Und unter Umständen kann eine offene Gesellschaft, die Pluralismus nicht antastet, ohne Parteien im konventionellen Sinne auskommen. Die Zukunft der Parteien ist offen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 125 – Thema: Gesichter der Zukunft. Das Heft können Sie hier bestellen.



















