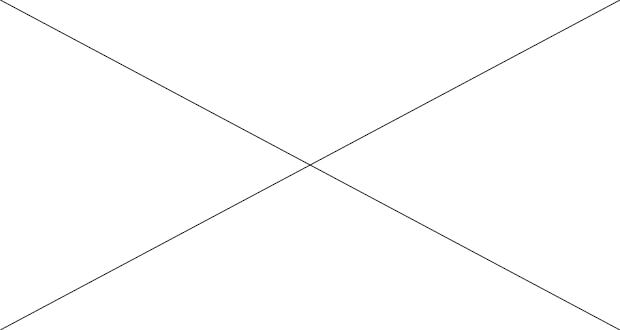p&k: Herr Geldof, Sie sind oft in Deutschland, um Kampagnen gegen Armut zu unterstützen. Sind deutsche Politiker wirklich aufgeschlossen gegenüber Ihrem Anliegen?
Bob Geldof: Ich glaube, dass Afrika anfangs kein so wichtiges Thema für die Politiker war, auch in Deutschland nicht. Aber es hat an Bedeutung gewonnen. Ich will nicht behaupten, dass das an unserer Arbeit liegt, doch haben wir Armut zu einem wahrnehmbaren Thema gemacht. Ich glaube, dass sie irgendwann begriffen haben, dass effektive Politik gegen Armut vor allem eins ist: eine gute Wirtschaftspolitik. Jetzt stellen die Politiker fest, dass man die Krise nicht in den Griff bekommen kann, ohne dass man eine umfassende internationale Kooperation eingeht. Ich empfinde heute fast ein bisschen Schadenfreude, denn wir haben es jahrelang gesagt: Die Weltwirtschaft kann nicht funktionieren, ohne dass wir eine Handelsrunde schaffen, die die Situation der Armen zur Kenntnis nimmt. Diese eher ökonomischen Argumente haben dazu beigetragen, das Anliegen interessant zu machen – mehr als die moralischen Argumente. Zuerst haben wir durch Band Aid und Live Aid eine große Lobby geschaffen, um auf die Situation der Armen aufmerksam zu machen. Dann begannen wir, uns mit den Strukturen von Armut zu beschäftigen und haben gesehen, dass bloße Wohltätigkeitsveranstaltungen irgendwann nicht mehr reichen. Als sich aber so viele Menschen „Live Aid“ und „Live 8“ anschauten, bekamen die Politiker plötzlich Interesse, denn all diese Menschen waren potenzielle Wähler. Wir Musiker waren Gestalten, die bei den Wählern populär sind – und die Politiker wollten bei den Wählern populär sein.
Macht die Finanzkrise Lobbyarbeit für Afrika schwieriger?
Zu meiner absoluten Überraschung ist das Gegenteil der Fall. One hat eine Meinungsumfrage in Auftrag gegeben, bei der herauskam, dass die Mehrheit der Deutschen persönliche Einbußen in Kauf nehmen würde, um etwas gegen Armut zu tun. Obwohl wir in Zeiten existenzieller ökonomischer Angst leben, sagen 59 Prozent der Menschen in diesem Land, dass es für ihre Wahlentscheidung sehr wichtig sein wird, wie sich die Parteien zu diesem Thema verhalten. Und das sagt jetzt übrigens nicht Bob Geldof, das sagt nicht einmal die Organisation One – nein, das hat eine empirische und objektive Umfrage ergeben. Die Mehrheit von 52 Prozent wäre bereit, eine größere Last auf sich zu nehmen, um die Versprechen an die Ärmsten der Welt zu halten. Das ist nicht nur ein außerordentliches Kompliment für Deutschland – das ist eine Zahl von großer politischer Bedeutung. Unsere Lobbyarbeit ist in der Krise einfacher geworden – aber was jetzt dennoch schwieriger ist, ist die Leute emotional zu erreichen. Wir können heute keine Bilder von hungernden Kindern mehr zeigen, das funktioniert jetzt nicht. Wir müssen über die empirischen ökonomischen Fakten reden.
Wenn Sie sich die großen Summen ansehen, welche die Regierungen ausgeben, um die Wirtschaft zu retten – haben Sie da nicht Sorge, dass der Kampf gegen die Armut dabei letztlich doch auf der Strecke bleibt?
Wenn die Regierungen uns sagen: „Wir werden in diesem Jahr den Betrag X für Afrika ausgeben“, dann müssen wir ihnen sagen: „Aber Ihr habt Y versprochen. Und um zu Y zu kommen, müsst Ihr noch Z drauflegen.“ Vergessen Sie die Budgets, die vor zwei Monaten gegolten haben! Plötzlich haben wir Milliarden, um die Wirtschaft zu retten. Wenn wir 50 Milliarden ausgeben, um eine Bank zu retten, dann wird der winzige Betrag, der unserer Meinung nach in den Kampf gegen Armut fließen sollte, in der Presse überhaupt nicht wahrgenommen. Die Rede der Bundeskanzlerin beim Weltwirtschaftsforum war eine exzellente Rede: Sie hat klargemacht, dass wir nur mit internationaler Kooperation weiterkommen. Es nutzt nichts, wenn jedes Land nur versucht, sich selbst zu retten. Die Kanzlerin investiert hundert Millionen Euro in einen Infrastrukturfonds der Weltbank – das ist gute Politik! Und das hat die deutsche Regierung beschlossen, bevor wir mit der Meinungsstudie an die Öffentlichkeit gegangen sind. So etwas ist sehr hilfreich, um eine neue Nach-Rezessionsarchitektur zu schaffen. Wir brauchen neue Strukturen. Die alten Nachkriegsstrukturen der Weltbank müssen weg.
Werden Sie die deutsche Kanzlerin dieses Jahr wieder treffen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir verstehen uns ganz gut. Es ist zwar nicht entscheidend, dass ich mich mit Politikern verstehe, aber ich kann einige ganz gut leiden – auch wenn wir nicht unbedingt einer Meinung sind. Ich unterscheide zwischen der Person und dem Amt. Angela Merkel war uns gegenüber nie weniger als korrekt. Sie hat uns ganz genau gesagt, was sie tun kann und was sie nicht tun kann. Und sie erklärt uns auch, warum sie etwas nicht tun kann. Sie war, insbesondere beim Gipfel in Heiligendamm, unglaublich entgegenkommend. Sie hat sich viel Zeit genommen. Aber sie hat auch gesagt: „Sorry, aber ich kann das, was Sie wollen, nicht tun.“ Gerhard Schröder habe ich beim G-8-Gipfel in Gleneagles getroffen. Er war da ziemlich eindeutig, und ehrlich gesagt: Er war nicht wirklich interessiert. Das ist die Wahrheit. Er dachte, er muss uns treffen, aber eigentlich war er gelangweilt von dem, was wir ihm erzählt haben. Ich bin aber ein Freund von Heidemarie (Wieczorek-Zeul, Anm. d. Red.) – wir reden viel miteinander. Ich komme auch gut klar mit den Beamten: Ich habe in Berlin schon mit Bernd Pfaffenbach auf der Bühne gestanden (Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Anm. d. Red.). Er spielt verdammt gut Gitarre. Und ich habe auch Frank-Walter Steinmeier schon getroffen.
Wenn die Rede von Entwicklungshilfe ist, wird das meistens unter dem Begriff „Kosten“ abgehandelt und nicht unter „Investition“. Muss sich das ändern?
Wenn wir von Entwicklungshilfe reden, ist das eigentlich ein Widerspruch in sich. Das klingt nach einem Netz, das ausgeworfen und nicht wieder eingeholt wird. Das ist, als ob ich jemandem auf der Straße fünf Euro gebe. Er bekommt das Geld – und tschüss. Gut, vielleicht ist die Gegenleistung dafür, dass ich mich dann ein bisschen besser fühle. Bislang aber war Entwicklungshilfe der Preis, den die Regierung bezahlte, um die Lobbyisten loszuwerden.
Der wirtschaftliche Boom, den wir vor der Krise hatten, resultierte aus der Globalisierung. Aus der Massenkommunikation. Das ist keine philosophische Idee, sondern eine empirische Realität. Wenn wir alle beständig miteinander in Kontakt stehen, kann das Reichtum schaffen. Eine andere Seite der Globalisierung ist, dass sie Kooperation erzwingt. Doch 50 Prozent der Menschheit lassen wir im Regen stehen. Wenn die Uno sagt: Wir wollen die Hälfte der Armen von der Armut befreien, ist das gut – aber warum sollten wir sie nicht alle befreien? Auch hier muss man wieder wirtschaftlich argumentieren, wie wir es schon beim Gipfel in Heiligendamm getan haben: Wenn Ihr Jobs in Deutschland wollt und die Exportnation Nummer Eins bleiben wollt, dann nehmt Afrika endlich als 900 Millionen Produzenten und Konsumenten wahr. Leute, da ist euer Markt! Nur 14 Kilometer von Europa entfernt. Ihr wollt deutsche Jobs? Geht nach Afrika!
Sie wirken wie ein Mann, der eine Mission hat. Wie wichtig ist der Kampf gegen die Armut für Sie persönlich?
Es langweilt mich! Ich bin ein Musiker, der dieses Jahr ein Album rausbringen will … Spaß beiseite: Es langweilt mich nicht wirklich. Aber ich mache ja auch Geschäfte. Ich mache Geschäfte für meinen Bauch. Ich mache Politik für mein Hirn. Ich mache Musik für meine Seele, und ich habe meine Familie für mein Herz – und genau das ist die Formel, nach der Sie mich aufteilen können.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Die 10 Trends der Politikberatung. Das Heft können Sie hier bestellen.