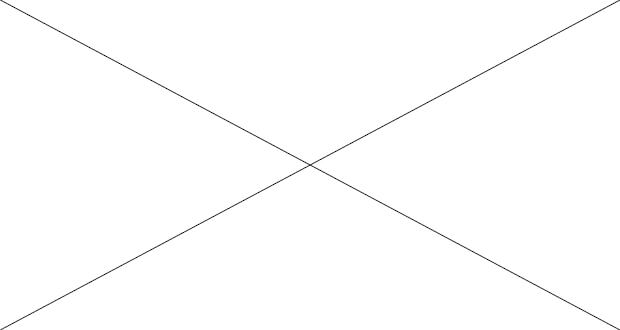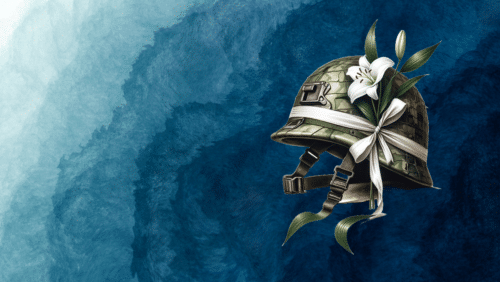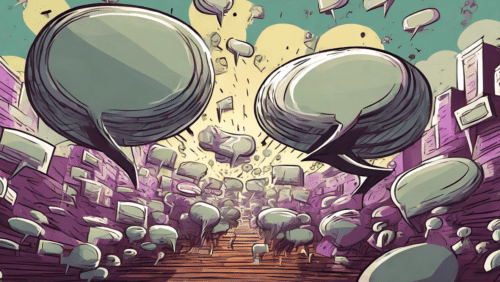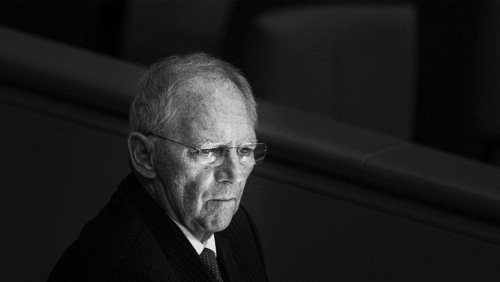Wählervereinigungen, „Unabhängige Bürger“ und „Freie Wähler“ – überall sind sie auf dem Vormarsch. Es gibt Landstriche in Deutschland, in denen sie auf kommunaler Ebene die traditionellen Parteien weit zurückgedrängt haben. In Baden-Württemberg stellen die Freien Wähler inzwischen fast die Hälfte aller Gemeinderäte und ein Viertel der Kreisräte, in Bayern ein Drittel aller Bürgermeister und 14 Landräte. Aber die freien Wählergruppen haben auch die Gemeinden im Norden der Republik längst erobert. Nach eigenen Angaben haben die Freien Wähler bundesweit 280.000 Mitglieder – das ist fast doppelt so viel wie Grüne, Linke und FDP zusammen. Solche Erfolge machen Lust auf mehr! Und deshalb ist es kaum verwunderlich, dass die Freien Wähler vielerorts den Weg von den Gemeinden in die Länderparlamente beschreiten wollen. Vorläufiger Höhepunkt ist der Einzug als drittstärkste Kraft in den Bayerischen Landtag im September. Bundesweit können sich – so eine Forsa-Umfrage – sagenhafte 45 Prozent der Wähler vorstellen, bei der nächsten Landtagswahl für die Freien Wähler zu stimmen.
Kommunalpolitisch verankert
Wer aber sind diese Freien Wähler überhaupt, und was wollen sie? Sie treten zwar bei Wahlen an und beteiligen sich an der parlamentarischen Arbeit auf kommunaler Ebene, verfügen jedoch in aller Regel weder über den formalen Status einer Partei – noch wird dieser überhaupt angestrebt. Der als eingetragener Verein organisierte Bundesverband Freie Wähler, in welchem die Landesverbände lose zusammengeschlossen sind, verfügt kaum über tatsächliche Handlungs- und Entscheidungsmacht. Stattdessen sind es die kommunalen Gliederungen, die das Erscheinungsbild prägen. Diese kommunalpolitische Verankerung führt dazu, dass ihre programmatische Ausrichtung zuallererst an der Arbeit in den Kommunen orientiert ist, wo – vielfach kompetent und sachorientiert – über Fragen der Abwasserbewirtschaftung, der Ortskernverschönerung oder der Grünanlagenpflege debattiert wird. Allerdings ergibt sich aus der Summe solcher kommunalpolitischer Erfahrungen noch lange kein konsistentes landespolitisches Programm. Und so versuchen die Freien Wähler in zunehmendem Maße, auch landes- und bundespolitische Themen zu besetzen. Kern dieses Versuchs ist das Leitbild der Bürgernähe, um welches herum sich Forderungen nach mehr direktdemokratischen Elementen, nach einer Stärkung der Kompetenzen von Städten und Gemeinden sowie nach einer besseren Förderung von ländlichem Raum und bäuerlicher Kulturlandschaft lagern. Dazu kommt eine Parteienkritik, die teils auf den umstrittenen Thesen des Verfassungsrechtlers Hans-Herbert von Arnim beruht. Insgesamt verfügen die Freien Wähler auf landespolitischer Ebene über keine konsistenten Programme, häufig werden konkrete Festlegungen vermieden („Dreigliedrig, zweigliedrig oder Gesamtschule? Glaubenskriege vermeiden!“). Parteienschelte, Globalisierungskritik, Landidylle und eine Prise Antizentralismus zeugen eher von der inneren Vielgestaltigkeit und Heterogenität der Freien Wähler als von einer widerspruchsfreien landes- oder gar bundespolitischen Vision.
Zu dieser programmatischen Ambivalenz kommt, dass die Freien Wähler entlang dreier wichtiger Fragestellungen gespalten sind: Erstens ist unklar, ob man sich auch in Zukunft auf die kommunale Ebene beschränken soll, wie es etwa der baden-württembergische Landesverband fordert, oder ob der Einzug in die Länderparlamente angestrebt werden soll. Zweitens ist umstritten, ob sich die Freien Wähler auf Bundesebene in das enge Korsett der Organisationsstruktur einer Partei zwängen wollen, oder ob der Bundesverband lediglich als loser Dachverband agieren soll. Und drittens ist weder in der Außenwahrnehmung noch im inneren Selbstbild die Frage beantwortet, wie sich die Freien Wähler im deutschen Parteienspektrum einordnen wollen. Sind sie nun eher „konservativ“ oder eher „links“, eher eine Partei der Mitte oder gar eine Anti-Parteien-Partei? Zwar finden sich in den Programmen vieler Wählervereinigungen traditionell linke Forderungen, wie etwa die Ablehnung der Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge. Generell rechnen sie sich aber eher dem „bürgerlichen Lager“ zu.
Vor diesem Hintergrund stellt sich erst recht die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis der Freien Wähler. Warum sind diese trotz innerer Zerrissenheit, trotz dünner Programmatik und trotz uneinheitlicher Visionen darüber, in welche Richtung es weitergehen soll, so erfolgreich? Erstens gilt auch für die Erfolge der Freien Wähler: Die Schwäche der Gegner ist die eigene Stärke. Von einer Schwäche der Volksparteien profitieren nicht nur Grüne, Linke und FDP, sondern auch Protestparteien und freie Wählervereinigungen. Gerade in Bayern gelang es, Zuspruch von ehemaligen CSU-Wählern zu gewinnen, die mit der Führung von Partei und Freistaat durch Erwin Huber und Günther Beckstein unzufrieden waren. Fast 200.000 Stimmen verlor die CSU im Herbst an die Freien Wähler. Die bayerischen Freien Wähler sind also Fleisch vom Fleische der CSU. Zweitens neigt zumindest ein Teil der unabhängigen Wählervereinigungen zu populistischer Bedienung allseits bekannter Vorurteile. Mit einer Mischung aus anti-pluralistischem „Wider-dem-Parteiengezänk“, anti-europäischem „Wider-die-Brüsseler-Bürokratie“ und populistischem „Wir-da-unten-gegen-die-da-oben“ wird mancherorts versucht, aus der sich ausbreitenden Politik- und Politikerverdrossenheit Kapital zu schlagen – mitunter durchaus erfolgreich.
Parteienverdrossenheit genutzt
Drittens nützt den Freien Wählern in Zeiten zunehmender Parteienverdrossenheit auch ihre symbolisch überaus bedeutsame Abgrenzung von den „normalen“ Parteien. Gerade auf kommunaler Ebene finden sich häufig Honoratioren und „verdiente Persönlichkeiten“, die ganz explizit auf ein Parteibuch verzichten. Der Chef der Freien Wähler in Baden-Württemberg, Heinz Kälberer, formuliert es so: „Wir sind genau deshalb so erfolgreich, weil wir keine Partei sind“, und auf der Webseite des Bundesverbandes wird geworben: „Sagen Sie nein zu den Parteien“. Häufig geht mit diesem Selbstverständnis auch die Aussage einher, statt „Parteipolitik“ bedürfe es in Deutschland konsequenter „Sachpolitik“. Dies widerspricht zwar der Funktionslogik unseres pluralistischen und auf repräsentativer Demokratie basierenden parlamentarischen Regierungssystems, es passt aber gut in die weit verbreitete Vorstellung vieler Deutscher, im Grunde sei in der Politik doch einfach das „objektiv Richtige zu tun“, statt sich im langwierigen Streit der Meinungen zu verlieren.
Welche Folgen hat nun all das für das deutsche Parteiensystem, für das Politikmachen in Deutschland und für die politische Kultur im Land? Wird aus dem sich inzwischen bundesweit durchsetzenden Fünfparteiensystem demnächst ein noch komplizierteres Sechsparteiensystem? Werden den schrumpfenden Volksparteien neben Grünen, Linken und FDP auch noch die Freien Wähler gegenüberstehen? Zumindest vorerst ist dies nicht zu erwarten, schließlich gelingt den Freien Wählern ein bundesweit einheitliches Auftreten kaum, und viele Landesverbände stemmen sich gegen das Verlassen der kommunalen Nische. Normalität dürften auf absehbare Zeit eher jene 0,9 Prozent bleiben, welche die Freien Wähler bei den Landtagswahlen in Hessen gewinnen konnten, als die bayerischen 10,2 Prozent. Für die Aufgabe der Bildung stabiler Regierungen in den Ländern ist dies eine gute Nachricht.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Verhandeln – Die vernachlässigte Kunst. Das Heft können Sie hier bestellen.