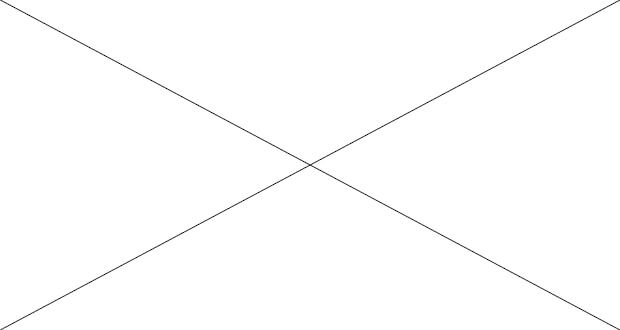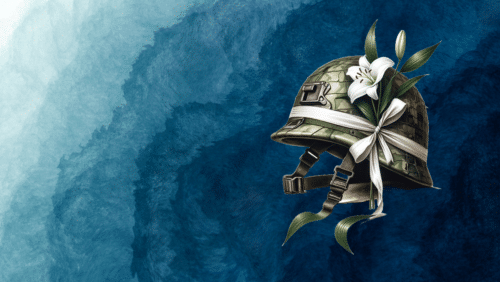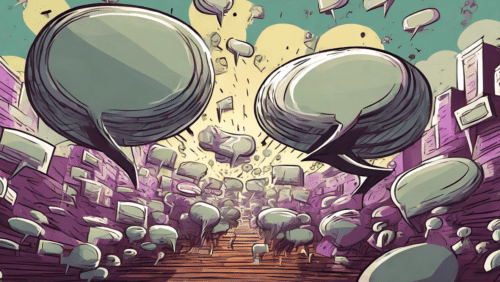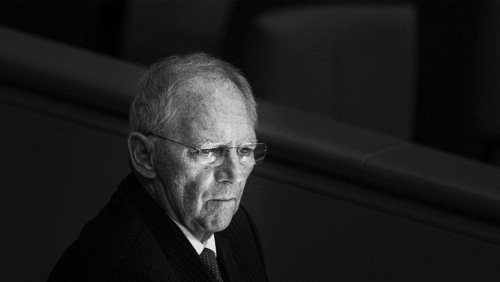p&k: Frau Dehmer, Herr Blohm ist Interessenvertreter der Tabakindustrie. Entwickeln Sie als Journalistin spontan Vertrauen, wenn sie auf Interessenvertreter treffen?
Dagmar Dehmer: Jeder ist Interessenvertreter. Ich bin da einigermaßen unbelastet. Es hängt vom Gespräch ab, ob ich Vertrauen entwickle oder nicht. Jeder will irgendetwas verkaufen, wenn er mit Journalisten spricht – das ist ja auch legitim. Ich muss dann nur sortieren, was ich am Ende glauben kann und was nicht, und ob ich Möglichkeiten habe, das gegenzuchecken oder nicht. Diese Möglichkeit ist nicht immer gegeben.
Herr Bürsch, vertrauen Sie Interessenvertretern?
Michael Bürsch: Über die Beteiligung von Interessenvertretern – andere sagen: Lobbyisten – führe ich eine längere Debatte, unter anderem mit Heribert Prantl von der „Süddeutschen Zeitung“. Prantl moniert, dass ich vor vier Jahren im Gesetzgebungsprozess über öffentlich-private Partnerschaften 60 Interessenvertreter eingeladen habe, und zwar zu Beginn des Prozesses und nicht am Ende. Keiner davon hat übrigens auch nur eine Zeile des Gesetzestextes geschrieben. Ich will immer genau wissen, wer welches Interesse hat. Ich setze gerne alle an einen Tisch, die damit zu tun haben: die Anwälte, den Bauverband, die Banken – alle, die an dem Thema ein Interesse haben. Und dann setze ich eine Gruppe aus den Ministerien und eine Gruppe Abgeordneter dazu, also drei Blöcke. Und jetzt sollen erstmal die Interessenvertreter untereinander klären, was sie eigentlich wollen. Als Abgeordneter kann ich das alles gar nicht wissen, was ich nachher gegeneinander abwägen soll.
Das heißt, wenn man offen miteinander redet und alle Interessen offen auf den Tisch legt – dann haben Sie auch Vertrauen?
Bürsch: Ja, dann kann ich abwägen, welche Argumente ich mir zu Eigen mache und welche nicht. Das verlangt absolute Transparenz, das ist vollkommen klar, aber das ist auch zehn Mal besser als das, was zuweilen auch passiert: wenn etwa Pharmavertreter im Gesundheitsministerium beteiligt werden und da klammheimlich irgendwelche Gesetzesformulierungen einbringen. Ich will einen ganz offenen Prozess: Interessen auf den Tisch. Was wollt ihr? Was könnt ihr euch vorstellen? Maximalforderungen werden sowieso nicht erfüllt. Das ist viel besser, als wenn ich die Informationen nur aus zweiter Hand erhalte.
Herr Blohm, ist das eine gute Idee, so zu verfahren?
Sebastian Blohm: Ja, natürlich. Transparenz und offener Dialog sind wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Es gibt Spielregeln, die allen Beteiligten klar sind. Wer gegen diese Spielregeln verstößt, der verliert Vertrauen ganz schnell. Wenn ich zu einem Thema eine Position vertrete und diese mit Argumenten unterfüttere, dann hat mein Gesprächspartner kein Interesse mehr an einem weiteren Gespräch, wenn diese Argumente eine Halbwertzeit von ein bis zwei Tagen haben, bis sie widerlegt werden. Wenn man die Spielregeln einhält, dann kann man tatsächlich bei unterschiedlichen Interessen, manchmal auch gegensätzlichen Interessen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufbauen.
Bürsch: Um das klarzustellen: Es ist nicht so, dass ich den Interessenvertretern oder Lobbyisten durch die Bank vertraue. Es geht darum, ihnen nicht von vornherein zu misstrauen und zu denken: Das ist doch sowieso alles gelenkt und vorgetäuscht und nur so ausgelegt, dass nur ihre Interessen zum Tragen kommen. Nein, die guten Interessenvertreter machen das nämlich genau so, wie Herr Blohm es geschildert hat: Die tragen ihr Argument so vor, dass es haltbar ist und zeigen, dass sie auch mal über den Tellerrand blicken.
Frau Dehmer, Sie kommen bei Ihrer Arbeit oft in Berührung mit Projekten zur „Corporate Social Responsibility“, mit CSR. Wann erscheint Ihnen so etwas glaubwürdig?
Dehmer: Das hängt immer vom Unternehmen ab. Ein Beispiel, bei dem mich das Projekt überzeugt hat, ist Shell. Nach den Skandalen um Brent Spar und den Bürgerrechtler Ken Saro-Wiwa, der in Nigeria hingerichtet wurde (weil er sich gegen die Ausbeutung des Landes zum Zwecke der Erdölförderung wandte, Anm. d. Red.), war Shell, was die Glaubwürdigkeit angeht, wirklich komplett am Boden. Sie haben es eingesehen und begonnen nachzudenken, wie sie künftig Firmenpolitik machen wollen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass sie, als sie in Gabun ins Ölgeschäft einstiegen, das renommierte Smithsonian-Institut einluden, um zunächst einmal eine Analyse der Biodiversität in der Region zu machen, in der das Öl gefördert werden sollte. Sie haben aus Fehlern gelernt. Doch hat darüber niemand geschrieben. Das war für mich aber glaubwürdig. Wenn RWE jetzt behauptet, sie würden in Zukunft ganz viel in erneuerbare Energie investieren, dann überzeugt mich das noch nicht, weil das bisher einfach noch nicht stattgefunden hat. Mit Verlaub: Bevor ich keine Änderungen sehe, glaube ich auch nicht, dass sie wirklich etwas ändern.
Wenn man mit so einem unabhängigen Partner arbeitet wie dem Smithsonian-Institut, stärkt das dann die Glaubwürdigkeit?
Bürsch: Lassen Sie uns doch zunächst einmal klären, worüber wir reden: über gesellschaftliches Engagement von Unternehmen, um die englische Abkürzung CSR zu vermeiden, die in Deutschland kaum einer kennt. Nach einer heute noch gültigen Studie aus dem Jahr 2007 sagen etwa 95 Prozent aller Unternehmer Deutschlands: „Natürlich engagieren wir uns gesellschaftlich“. Bei der Nachfrage kommt dann aber raus: 84 Prozent davon verstehen darunter Spenden und Sponsoring. Dass heißt: Ich gebe hier mal ein bisschen Geld, und da hat die Frau des Vorstandsvorsitzenden eine Idee. Ich mache hier was für die Kultur und da was für Kinder, das gibt auch gute Pressefotos. Ich will das nicht herabsetzen, aber das ist im Grunde kein gesellschaftliches Engagement, das eine nachhaltige Wirkung haben kann.
Wie sieht ein solches denn aus?
Bürsch: Das sieht so aus, dass ein Unternehmen danach fragt, was gesellschaftlich sinnvoll ist und nicht danach, wo es die beste PR gibt oder die besten Bilder, die womöglich jemanden zu Tränen rühren. Nein, die erste Frage muss immer lauten: Wo ist der gesellschaftliche Bedarf? Zweitens geht es darum, das Thema – ohne Überforderung des Unternehmens – in die Geschäftsstrategie zu integrieren und drittens, sich die passenden Partner für das Projekt zu suchen.
Der Sänger und Afrika-Aktivist Bob Geldof hat kürzlich in einem Gespräch mit p&k gesagt, die Finanzkrise würde uns lehren, dass kein Weg an einer dauerhaften Kooperation aller gesellschaftlichen Akteure vorbeiführen würde.
Bürsch: Ja. Neoliberalismus fährt die Sache gegen die Wand.
Mit wem kooperieren Sie, Herr Blohm?
Blohm: Mit unterschiedlichen Interessengruppen. Ich glaube, das geht ein bisschen über den Bereich Politik hinaus. Gerade in der Finanzkrise ist es entscheidend, dass unsere Eigentümer und Investoren Vertrauen haben. Dass sie das haben, zeigt sich darin, dass weder unser Aktienkurs eingebrochen ist, noch dass wir Menschen entlassen mussten. Wir stellen jetzt sogar ein. Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun.
Reemtsma nimmt auf seiner Webseite Zweifel vorweg, indem dort die Frage beantwortet wird: „Machen Sie CSR nur wegen des Images?“ Journalisten begegnen Ihrem Engagement oft mit Argwohn – ist der Argwohn so groß, dass Sie das selbst schon aufgreifen?
Blohm: Ich bin ja ehemaliger Journalist, ich antizipiere das ein bisschen. Der Argwohn ist völlig normal. Unternehmen, die glaubwürdig sein wollen, müssen CSR an ihrem Geschäft entlang ausrichten. Wenn wir Kunst fördern würden, würden sich die Leute fragen, warum wir ausgerechnet das machen. Es hätte keinen Bezug zu unserem Geschäft. Wir müssen anderswo ansetzen: Wie bauen wir Tabak an? In welcher Form benutzen wir Pflanzenschutzmittel? Wie stehen wir zu Kinderarbeit? Wie ist die CO2-Quote unserer Werke? Wir sollten uns an der Produktschöpfungskette orientieren. Da müssen wir den Fragen der Journalisten und der Politik standhalten.
Bürsch: Es ist tatsächlich ein Trend, dass Unternehmen beginnen, für ihr Produkt und seine Wirkung Verantwortung zu übernehmen. Coca-Cola kümmert sich jetzt zum Beispiel ernsthaft um Fettsucht bei Kindern. Da wird auch erst einmal vermutet, dass es um PR geht, aber wenn man sich das näher anguckt, steht da wirklich ein ernsthaftes Bemühen hinter.
Normalerweise unterstellt man einem Unternehmen doch, dass das Gewinnstreben dominiert. Wenn Coca-Cola sagt, man solle Kinder nicht zu viel davon trinken lassen, widerspricht das ja dem unternehmerischen Ziel, den Gewinn zu maximieren. Sie nehmen es dem Unternehmen wirklich ab, wenn es signalisiert: Hier stellen wir unsere Verantwortung über den Gewinn?
Bürsch: Ja, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Der Lackmustest ist, wie ernsthaft, wie nachhaltig, wie intensiv das gemacht wird – und wie wenig dabei zunächst die Außenwirkung eine Rolle spielt. Ich weiß aus der Getränkeindustrie, dass Unternehmen wie Bacardi sich offenbar auch Gedanken darüber machen, welche Wirkung Alkohol bei Jugendlichen hat und wie sie darüber aufklären können. Da denkt man zunächst auch, dass das doch eigentlich kontraproduktiv für das Unternehmen ist, weil es vielleicht den Umsatz ein wenig mindert – tatsächlich ist es klug und langfristig gedacht.
Frau Dehmer, gehen die Medien immer ganz wertfrei an bürgerschaftliches Engagement von Wirtschaftsunternehmen heran oder dominiert da von vornherein die Skepsis?
Dehmer: Man geht nie wertfrei an irgendetwas ran, das wäre ja absurd. Als Journalistin will ich immer etwas Bestimmtes in Erfahrung bringen. Natürlich bewahre ich mir erst einmal eine gewisse Distanz, wenn ich mit jemandem spreche. Ich höre mir alles an, lasse es sich erst setzen und schaue dann, was mit den Informationen zusammenpasst, die ich vorher schon hatte.
Herr Bürsch, Sie haben Recht, dass man von Unternehmen nicht erwarten kann, dass sie gleich die Produktion einstellen. Aber ich kann erwarten, dass sie über ihre Produkte und die Risiken der Produkte informieren. Das erhöht schließlich die Glaubwürdigkeit. Wenn Coca-Cola darüber aufklärt, dass man nicht zu viel davon trinken sollte, anstatt Schulkantinen zu sponsern, finde ich das schon einen großen Fortschritt. Das finde ich deutlich glaubwürdiger, als wenn Unternehmen ganz weit weg vom eigenen Produkt CSR-Projekte unterstützen. Bei letzterem habe ich eher den Verdacht, dass es nur der Imagepflege dient, als wenn es etwas ist, das aus dem Unternehmen heraus wächst.
Wieviel Überzeugung muss man denn von einem Unternehmen fordern, wenn es sich gesellschaftlich engagiert? Wenn jemand zum Zwecke der Imagepflege Gutes tut, ist das ja auch nicht schlecht.
Dehmer: Ich finde, dass sich das eher an der Wirkung misst. Mir ist verhältnismäßig egal, wie motiviert da jemand rangeht. Klar ist, dass solche Projekte nicht laufen und nicht funktionieren, wenn die Unternehmensspitze das Projekt nicht will. Das ist ganz klar. Ein Umweltbeauftragter, der nur dazu da ist, die Lücken in den Gesetzen zu finden, ist eben ein Umweltbeauftragter, der dem Unternehmen hilft, sein Image zu befördern. Etwas ganz anderes ist ein Umweltbeauftragter, der die Wirkung der eigenen Produktion überprüft und Vorschläge macht, wie man sie verbessern kann.
Blohm: Es gibt große Unterschiede von Unternehmen zu Unternehmen. In unserer Branche ist es zum Beispiel ein Thema, dass Zigaretten-Automaten kinder- und jugendsicher gemacht wurden, indem eine elektronische Sperre eingebaut wurde, die nur mit Personalausweis zu entriegeln ist. Es gibt im Tabakhandel viele Mittelständler und Familienunternehmen, die diese technische Umstellung nicht hinbekommen haben. Wir haben ihnen klargemacht, dass wir sie dann nicht beliefern können und haben die Lieferung eingestellt. Bei so etwas muss man dann aber auch langfristig konsequent bleiben.
Somit wären wir beim Stichwort Nachhaltigkeit, das immer gerne angeführt wird.
Dehmer: Das ist genau die Vertrauensdebatte, die die Finanzkrise uns gebracht hat. Unternehmen, die so vorgehen, stehen besser da als Unternehmen, für die nur der kurzfristige Gewinn zählt.
Bürsch: Ich halte die Finanz- und Wirtschaftskrise einerseits für eine Chance, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, sie ist aber auch der Lackmustest, wie ernsthaft so ein Engagement wirklich ist. Was – nicht nur bei den Banken – an Vertrauen verloren gegangen ist, ist doch enorm. Und jetzt gibt es Unternehmen, die meinen, aufgrund der schwierigen Situation könnten sie kein gesellschaftliches Engagement mehr betreiben. Das ist kurzsichtig. Gerade jetzt muss man danach fragen, welchen Beitrag man leisten kann. Es geht nicht darum, die Mittel zu verdoppeln. Man mag sie sogar halbieren, wenn sie bitte nur zielgerichtet und strategisch richtig eingesetzt werden. Die Banken könnten gerade jetzt losmarschieren und Engagement zeigen: Sie könnten zum Beispiel Jugendliche im Umgang mit Geld schulen.
Frau Dehmer, Sie befassen sich beruflich mit Umweltfragen. Warum ist der Klimawandel während der Krise eigentlich fast von der Agenda verschwunden? Ist das den Medien anzulasten?
Dehmer: Beim Klima gibt es zurzeit mehrere Probleme, die es schwer machen, es zum Thema zu machen. Das eine ist, dass wir das Handlungsfenster, das wir hatten, eigentlich schon überschritten haben. Was wir real noch erreichen können, ist weit von dem entfernt, was wir erreichen wollten. Das so genannte Zwei-Grad-Ziel, maximal zwei Grad Erderwärmung bis zum Jahr 2100, haben wir verfehlt. Es dürfte jetzt sehr viel schneller gehen, als wir uns das gedacht haben. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Andererseits stecken wir in hochkomplexen internationalen Verhandlungen, wobei das Problem ist, dass die wichtigsten Spieler in diesem Jahr wählen: Deutschland wählt, Indien wählt, Südafrika wählt. Die sind jetzt alle fußlahm. Außerdem wechselt die EU-Kommission und wir haben eine neue amerikanische Regierung. Das ist eine Situation, in der keine Dynamik zu erwarten ist.
Kann man Politikern vertrauen, die sich trotz solch existenzieller Probleme nur um ihre Wiederwahl kümmern?
Dehmer: Naja, es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als Rücksichten zu nehmen, das sehe ich schon. Mit diesem Thema kann man mitten in der Finanzkrise keine Wahl gewinnen. Das ist anders als in Australien vor eineinhalb Jahren, als es das wahlentscheidende Thema war. Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf war es zunächst auch ein großes Thema. Aber natürlich hat die Finanzkrise die Klimafrage völlig überrollt. Alles, was länger als vier Wochen hin ist, ist im Moment ziemlich schwer vermittelbar.
Herr Blohm, engagieren Sie sich trotz Finanzkrise weiterhin gesellschaftlich?
Blohm: Bei uns spielt das Thema Aufklärung eine große Rolle. Wir glauben an eine offene Gesellschaft, in der Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen. Wir glauben nicht an eine Verbotskultur. Gleichzeitig übernehmen wir auch Verantwortung, indem wir die Leute über die Risiken des Rauchens aufklären, so dass sie frei entscheiden können. Das Thema Bildung ist deshalb für uns sehr wichtig: So haben wir zum Beispiel seit 50 Jahren ein Begabtenförderungswerk. Der Verein unterstützt Studenten und Schüler aus einkommensschwachen Familien. Das sind inzwischen über 5000. Aus den Stipendiaten sind Professoren, Manager oder Musiker geworden. Dieser Verein hat Zukunft. Das Budget ist auch fix und das bleibt so.
Frau Dehmer, wenn Sie Herrn Blohm einen Tipp geben müssten, wie er bei Ihnen Interesse für das Engagement seines Unternehmens wecken kann – welcher wäre das?
Dehmer: Das hängt echt vom Projekt ab. Wenn ich die Idee schon blöd finde, dann schreibe ich darüber gar nicht (lacht). Wenn das eine gute Idee ist, dann guck ich mir das auf jeden Fall mal an.
Bürsch: Es sollte wohl nach den von uns beschriebenen Grundsätzen nicht nur auf einen kurzfristigen PR-Effekt ausgerichtet sein …
Dehmer: Also wenn er sagt, wir machen jetzt mal ein Jugendlager für einkommensschwache Kinder und bringen denen da ganz viel bei, dann hat das keine Chance (lacht). Da finde ich das Stipendiatenprogramm sehr viel interessanter, das war übrigens tatsächlich eine gute Anregung, da vielleicht mal reinzuschauen, ob sich da ein paar interessante Geschichten ergeben.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Die Meinungsmacher. Das Heft können Sie hier bestellen.