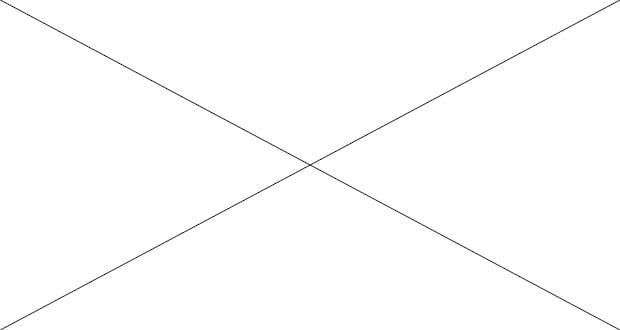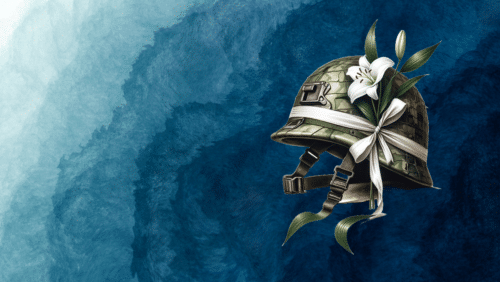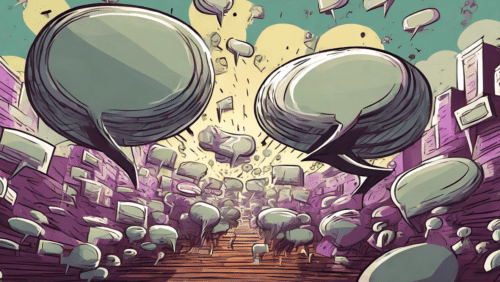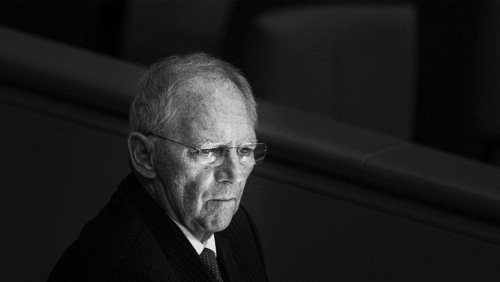Nie und nimmer dürfe man von Brückentechnologie sprechen, Kernenergie sei „kein Auslaufmodell“, sondern „eine Technologie mit Zukunft“! Der Auftraggeber reagiert entsetzt auf den Vorschlag der Kommunikationsagentur und weist ihn empört zurück. Der Chef des großen Energiekonzerns hatte 2006 die Agentur beauftragt, eine Strategie zu entwickeln, wie die Laufzeit der Kernenergie in Deutschland doch noch verlängert werden kann. Sprachlich sollte eine positive Grundstimmung erzeugt werden. Mundgerecht für Kernkraftbefürworter sollte die Schlüsselvokabel sein und leicht in den Sprachgebrauch der Bürger zu integrieren. „Brückentechnologie klingt negativ“, grollt der Chef verärgert, und der Begriff verschwindet für drei Jahre. 2009 kehrt die Brückentechnologie im Wahlprogramm der CDU mit großem Aplomb zurück und wird ein riesiger Erfolg. Die Agentur hat mit ihrer pfiffigen Erfindung das womöglich erfolgreichste Kunstwort der vergangenen Jahre entwickelt. Selbst bei Wikipedia ist es mittlerweile zu finden, und die Atomenergie dient dort nur als ein Beispiel dafür. Unerwähnt bleibt, dass es sich um ein interessengeleitetes Sprachprodukt handelt.
Das Wort gehört zu den wichtigsten Werkzeugen von Lobbyisten, für manche ist es überhaupt die wirkungsvollste Waffe. In den vergangenen Jahren haben sich Lobbyisten verstärkt damit befasst, wie man Einfluss durch geschicktes Hantieren mit Semantik gewinnt. Lobbyismus durch Sprache ist Bewusstseinsbildung und Bewusstseinsveränderung mit dem Ziel, Deutungshoheit im öffentlichen politischen Diskurs zu gewinnen. Nicht selten werden dabei die Grenzen zur Manipulation gestreift oder gar überschritten. Als Erfolg gilt, wenn sich Bürger von einer Kampagne mitgenommen fühlen, sich mit ihr identifizieren, ohne zu fragen: Welche Interessen werden verfolgt? Wer hat welche Gründe, sie zu finanzieren? So glauben auch heute noch viele Bürger, die Kampagne „Du bist Deutschland“ stamme von der Bundesregierung. Eine beachtliche Leistung der Medienkonzerne, die die Kampagne finanziert haben, und der Agenturen, die mit der Umsetzung beauftragt waren. Der Glücksatlas schaffte es 2011 in alle relevanten Abendnachrichten. Unkritisch, aber staunend wurde minutenlang im „Heute Journal“ über die vermeintlich wissenschaftliche Studie berichtet, die in Wahrheit ein PR-Produkt der Deutschen Post war.
Als Studien getarnte Kampagnen sind eher die Ausnahme. Vielmehr kommt es darauf an, Bilder zu vermitteln oder Fachjargon zu suggerieren. In der Regel werden eingängige, leicht in den Sprachgebrauch einzuflechtende Begriffe gebildet. So waren die Finanzmarktprodukte ein Erfolg der Bankenlobby, der durch die Umdeutung und Verkürzung der Bankenkrise zur Schuldenkrise noch getoppt wurde. Hedge-Fonds und allerlei spekulative Manöver wurden als Markt-Produkte etikettiert. Güter und Dienstleistungen sind ein Mittel zur Bedürfnisbefriedigung, das Ergebnis einer Wertschöpfungskette mit einem Nutzenversprechen für den Konsumenten. All das sind Finanzmarktprodukte, bei denen mit finanziellen Erträgen aus der Realwirtschaft spekuliert wird, nicht. Die Umdeklarierung von Verträgen zu Produkten entlastete die Banken-Lobby erheblich vom argumentativen Aufwand für die Begründung von Deregulierungen. Recht hintersinnig ist dagegen die Unterscheidung von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Einerseits hebt sie die Finanzwirtschaft auf Augenhöhe mit der Realwirtschaft. Andererseits ist der wirkliche Gegenpart einer Realwirtschaft bei Lichte gesehen eine Scheinwirtschaft.
Ist das Kunstwort erfolgreich im Diskurs eingepflegt, dann genügt es, wenn der Lobbyist im geeigneten Moment das richtige Stichwort ausspricht, also durch einen Reiz eine konditionierte Reaktion auslöst. In den Interviews zur vom Autor mitverfassten Lobby-Studie der Otto-Brenner-Stiftung wurden Fälle geschildert, bei denen Politiker der „Lobby-Sprache“ auf den Leim gegangen sind: Sie glaubten, eine rationale Entscheidung getroffen zu haben, mussten aber später feststellen, dass sprachliche Manöver bei ihnen Assoziationen ausgelöst hatten, die ihren Blick verengten.
Das besondere Interesse der Wortschöpfer gilt positiven Begriffen, denen man idealerweise zustimmt, ohne sie kritisch hinterfragen zu müssen. In der Praxis existieren drei Arbeitsmethoden, auf die je nach Anlass und Zweck zurückgegriffen wird. Da ist zunächst das Mittel der Begriffskreation. Neue Begriffe sind zu finden, um eine interessengeleitete Botschaft in einfachen, eingängigen Worten zu transportieren: Leistungsfreundliche Gesetze (Abbau von Arbeitnehmerrechten), Kluges Sparen (Sozialkürzungen), Versorgungssicherheit statt Stromlücken durch Energiemix (Laufzeitverlängerung). Atomkraft habe lediglich ein Restrisiko (Risiko) und Banker kündigen Gewinnwarnungen (Verluste) an. Und es macht auch einen Unterschied, ob man von Schulden oder von Ausgabenüberschüssen spricht. Misslungen ist der Versuch, die Gesundheitsprämie gegen die Kopfpauschale durchzusetzen.
Die zweite Methode ersetzt negativ besetze Begriffe durch bereits bestehende positivere, die das Gleiche meinen. Vor allem im Arbeitsmarktdiskurs, insbesondere bei der Zeitarbeit gibt es allerlei wohlklingende Begriffe. Allen voran Flexibilität, die als Synonym für Belastung benutzt wird. Der Prekär-Bereich im Dienstleistungswesen wird euphorisch Kreativwirtschaft genannt, die Arbeitsplätze sind nicht prekär, sondern lediglich hybride. Misslungen ist der Versuch, die Atomenergie durch Kernenergie zu ersetzen. Ein Witz eigentlich, dass gerade das Deutsche Atomforum bemüht ist, den eigenen Namensbestandteil zu vermeiden.
Die dritte Methode deutet Begriffe um, oft im Zusammenhang mit Schein-Kausalitäten. Deren Ziel ist es, einen fruchtbaren Boden im öffentlichen Diskurs für die spätere Lobbyarbeit zu bestellen. Entweder suggerieren sie eine scheinbar plausible Kausalität, wie es der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mit dem Slogan „Sozial ist, was Arbeit schafft“ gelungen ist. Oder sie negieren aggressiv Behauptungen, die eigens zum Zwecke der Negation aufgestellt werden, wie die Kampfphrase „Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer“. Schließlich hat niemand jemals ernsthaft behauptet, dass der Staat der bessere Unternehmer sei. Über eine gewisse Zeit gelang es den Kapital-Interessen, den Gerechtigkeitsdiskurs mit dem „Neid-Vorhalt“ zu irritieren.
Lobbyismus über Sprache findet vorwiegend in politischen Bereichen statt, in denen es um Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen oder um viel Geld geht. Die unsägliche Bezeichnung Hartz-IV-Familien oder die Heiligsprechung der Leistungsträger gegenüber den angeblichen Leistungsverweigerern ist die Sprache des Klassenkampfs von oben. Über die Verteidigungspolitik hat sich mit den Jahren ein Semantikschleier technokratischer Begriffe gelegt, der das Militärisch-Martialische in wohlklingende Watte packt. Aus Kampfeinsätzen wurde schlichtweg ein robustes Mandat. Die Rüstungslobby verhandelt über intelligente Wirksysteme (Streubomben), die Weichziele (Menschen) vernichten sollen. Zum Orwellschen Neusprech ist es nicht allzu weit.
Lobbyismus über Sprache kann wirken wie Arsen. Zunächst entfaltet sich die Wirkung unbemerkt, später kann man nur schwer nachweisen, woher es kam. Trotzdem ist die Arbeit an und mit Sprache nicht generell zu kritisieren. Im Gegenteil, sie kann und sie soll den politischen Diskurs bereichern. Aber es sollte transparent sein, woher neue Begriffe kommen und wer ein Interesse daran hat, dass sie verwendet werden. Eigentlich wäre es die ureigene Aufgabe von Journalisten, sich mit neuen Wortschöpfungen kritisch auseinanderzusetzen und sie nicht einfach zu übernehmen. Solange allerdings die öffentlich-rechtlichen Nachrichten ungerührt und unhinterfragt vom Kerneuropa (Spaltung für Kapitalinteressen) oder dem Vertrauen in die Märkte (Vertrauen in Banker) berichten, als seien das neutrale und selbstverständliche Begriffe, dürfen die die Erwartungen nicht allzu hoch sein.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Überleben – Krisenkommunikation für Politiker. Das Heft können Sie hier bestellen.