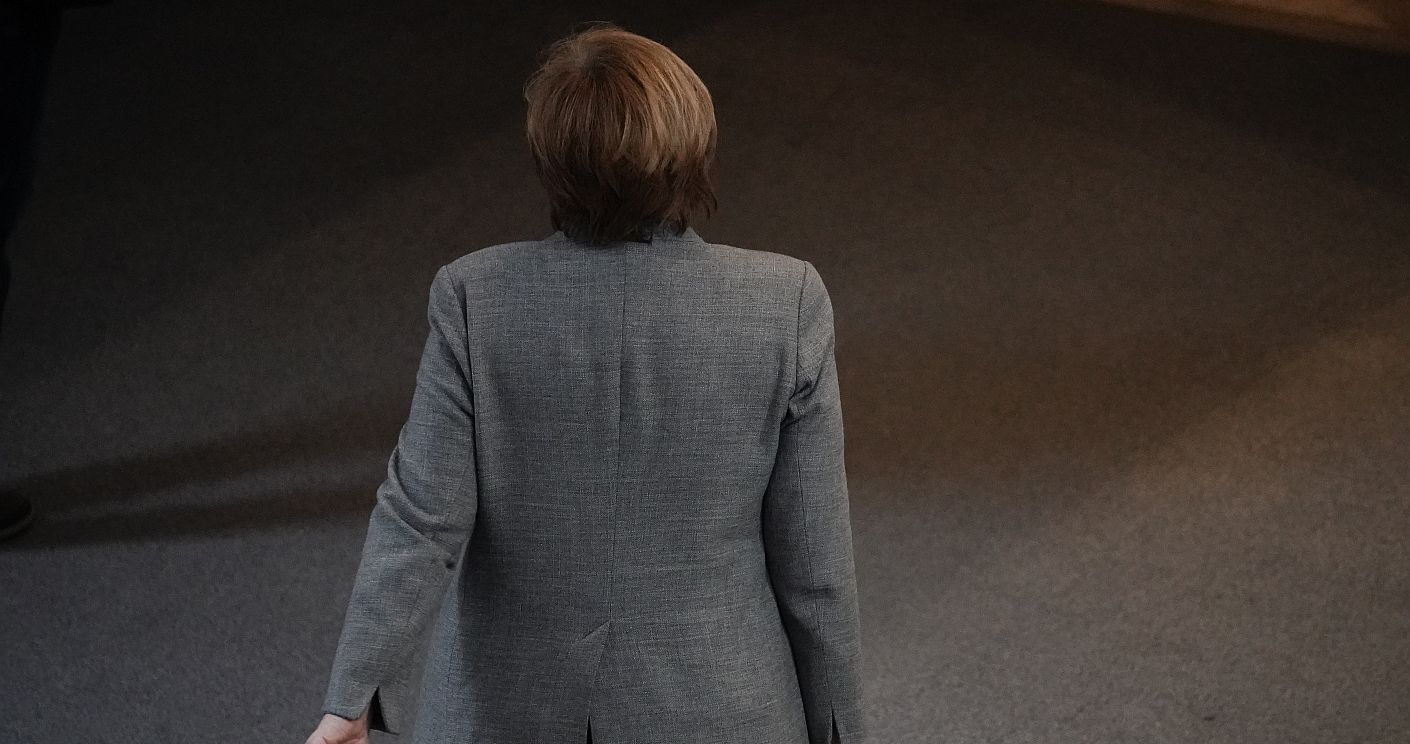Pflichtbewusstsein und Fleiß, politische Beweglichkeit und Ergebenheit in die Wirklichkeit: Das sind – gepaart mit Glück und Härte – die Grundlagen der Kanzlerschaft Angela Merkels gewesen. Deren Dauer hat mit mehr als 16 Jahren die Amtszeit Konrad Adenauers übertroffen und wird jene Helmut Kohls erreichen. Dazu ist nicht ausgeschlossen, dass Angela Merkel auch die nächste Neujahrsansprache zum Jahr 2022 noch zu halten hat. Höhen und Tiefen hat sie erlebt, Krisen und Katastrophen, nationale und internationale Herausforderungen hat sie bewältigt – wenigstens in dem Sinne, dass sie bei Bundestagswahlen immer aufs Neue bestätigt wurde.
Die Erfahrung, dass nicht die Programme von Parteien und Regierungen die Tagesordnung und die Agenda der Politik bestimmen, sondern die Wirklichkeit der Welt und des Landes, trug dazu bei. Nicht einmal ein Kanzler kann sich seine anstehenden Aufgaben freihändig aussuchen. Lehren hat sie beherzigt. Was heute wichtig und richtig erscheint, kann morgen schon überholt sein: Wer dieses Diktum der Politik nicht akzeptiert, kann sich in diesen Zeiten nicht über eine mehr als halbe Generation lang im vermeintlich mächtigsten Amt im Staate halten. Angela Merkel, die in der ehemaligen DDR groß gewordene Protestantin, hat es getan. “Wir werden sie noch vermissen”, bemerkten jetzt CDU-Parteifreunde, die wohl wissen, dass nach der Bundestagswahl nichts leichter für sie wird. Eine Ära erreicht ihr Ende.

Auf Augenhöhe: Angela Merkel mit Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und US-Präsident George W. Bush 2007 beim G8-Gipfel in Heiligendamm. (c) picture-alliance/dpa/Peter Kneffel
Merkel steht im Ruf, als Krisenkanzlerin in die Geschichte einzugehen: die internationale Finanzkrise, Griechenland und die Stabilität des Euro, die Katastrophe von Fukushima und der Atomausstieg, die Flüchtlingsbewegungen und der innenpolitische Streit darüber. Fast im Jahrestakt waren Arbeiten zu erledigen, die sie sich nicht ausgesucht hatte. Die vergangenen eineinhalb Jahre stehen sinnbildlich für den Verlauf ihrer ganzen Amtszeit: die Bündelung der Corona-Seuche, der Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und zuletzt der unwürdigen Umstände zum Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr.
Kanzlerschaft der Krisen
Was in Erinnerung bleibt, was gar als historisch zu bezeichnen ist? Es mag an Merkels Zugang zur Politik liegen oder auch an den Umständen, dass sich derzeit die Bewältigung von Krisen in einem geordneten Land als verbindendes Bild ihrer Kanzlerschaft festsetzt. Merkel glich darin Helmut Schmidt und dessen Kanzlerzeit in den 1970er Jahren: Ölkrise, Terrorismus standen als Aufgaben an, die zu erledigen waren, durch “gutes Regieren” eben. Historisch gesehen aber traten andere Kanzler in Erscheinung. Konrad Adenauer mit Wiederaufbau und Westintegration, Willy Brandt mit Aufbruch und Ostpolitik, Helmut Kohl mit deutscher Einheit und der Einführung des Euro und auch Gerhard Schröder mit den Sozialreformen der Agenda-2010-Politik.

Merkels Ehemann Joachim Sauer hielt sich immer aus der Öffentlichkeit zurück. Eine Ausnahme machte das Paar für die Bayreuther Festspiele. (c) picture alliance/Nicolas Armer/dpa
Und Merkel? Ihr bleibendes Erbe wird der Ausstieg Deutschlands aus der wirtschaftlichen Nutzung der Kernenergie sein, den sie im Frühjahr 2011 nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima für erforderlich hielt. Es war eine Kurswende sondergleichen. Ein halbes Jahr zuvor hatte die damalige schwarz-gelbe Koalition unter Merkel den Atomausstieg der rot-grünen Regierung Schröders kassiert und eine Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke durchgesetzt. Merkel handelte zwar nicht im Alleingang. Doch der Widerspruch hielt sich auch in ihrer eigenen Partei in engen Grenzen. Nicht zuletzt die Sorge um die Wahlaussichten der CDU trug dazu bei, dass der Kanzlerin gefolgt wurde. Der Erfolg blieb nicht aus: Bei der nachfolgenden Bundestagswahl 2013 erzielten die Unionsparteien das mit Abstand beste Ergebnis in Merkels Kanzlerjahren: 41,5 Prozent.
Die innerparteilichen Kritiker Merkels reihten sich in den Jubel ein. Doch war es nicht das erste Mal gewesen, dass Merkel eine Kurswende vollzog. Eine solche stand auch am Anfang ihrer Kanzlerschaft. Auf einem Parteitag Ende 2003 hatten die CDU-Delegierten ein Programm verabschiedet, das nach dem Tagungsort Leipziger Reformprogramm getauft wurde. Es folgte neoliberalem Gedankengut: Kopfpauschale statt gehaltsabhängiger Beiträge in der Krankenversicherung, Vereinfachung im Steuerrecht (“Bierdeckelsteuer”) einschließlich der Besteuerung von Nachtschichtarbeit.
Neoliberale Anfänge
Was als Neuanfang der deutschen Politik gedacht war, entpuppte sich als Rohrkrepierer. Die Empörung in weiten Teilen der Arbeitnehmerschaft war groß. Bei der – auf Drängen Schröders SPD um ein Jahr vorgezogenen – Bundestagswahl 2005 bekamen die Unionsparteien nicht wie erwartet das Mandat für eine schwarz-gelbe Koalition. CDU und CSU erhielten wie zur Quittung bloß 35,2 Prozent, fast dasselbe Ergebnis wie Helmut Kohl bei seiner Abwahl 1998. Merkel war auf die Bildung einer großen Koalition angewiesen. Umstandslos akzeptierte sie das Verlangen des SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, als Vorbedingung für Gespräche müsse sie auf die Beschlüsse von Leipzig verzichten. Das Zeitalter des Neoliberalismus sei damit beendet worden, vermerkte noch dieser Tage Horst Seehofer, der damals einzig verbliebene Wortführer des Sozialflügels der Unionsparteien.

Merkel und ihr Amtsvorgänger Gerhard Schröder (SPD). (c) picture-alliance/dpa/dpaweb/Peer Grimm
Dass es in der Rückschau Schröder gewesen war, der dazu beitrug, Merkel 2005 den Weg ins Kanzleramt zu ebnen, zählt zu den innenpolitischen Kuriositäten jener Jahre. Der bislang letzte SPD-Kanzler hätte die Bundestagswahl nicht vorziehen müssen. Er hätte den Rat des grünen Vizekanzlers Joschka Fischer und des Kanzleramtschefs Frank-Walter Steinmeier folgen können. Die rieten ihm ab und sagten voraus, die Agenda-2010-Politik werde die Arbeitslosigkeit in Deutschland senken und damit ein Baustein für einen Erfolg bei der regulären Bundestagswahl 2006 sein.
Das neue Wahlbündnis aus der ostdeutschen PDS und der westdeutschen linkssozialistischen WASG einschließlich Oskar Lafontaines, des vormaligen Chefs der deutschen Sozialdemokratie, kam auch wegen des neuen Wahltermins zustande – zu Lasten von Schröders SPD. Merkel profitierte davon. CDU und CSU wurden, wenn auch nur knapp, stärkste Gruppierung im Bundestag. Im Bündnis mit der SPD setzte Merkel ihr Ziel durch, als erste Frau in das Amt des Bundeskanzlers gewählt zu werden. Die Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt, die auf Schröders Reformagenda folgte, buchte Merkel als Erfolg auf ihr Konto.
Freundliches Umgarnen
Fortan verfolgte Merkel eine bislang ungewohnte Strategie in Wahlkämpfen. “Asymmetrische Demobilisierung” wurde sie genannt. Das gegnerische Lager nicht durch parteipolitische Polarisierung zu mobilisieren, sondern durch Politik und Wortwahl für sich einzunehmen – quasi einzuschläfern – war das Mittel. Die Methode entsprach Merkels Naturell. Das freundliche Umgarnen ist ihre Stärke – und Anlass für die Wortschöpfung gewesen, Merkel als “Mutti” zu bezeichnen. Es passt dazu, dass sie selbst zu den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die einst als Gegner der großen Koalition angetreten waren, regelmäßig persönliche Kontakte pflegt.

Da ist das Ding: Angela Merkel begutachtet den Corona-Impfstoff, den das Unternehmen von Biontech-Gründer Ugur Sahin (r.) entwickelt hat. (c) picture alliance/dpa/dpa/POOL/Arne Dedert
Ihre politischen Ziele konnte sie hinter der Scheinobjektivität von Analysen verbergen. Politik wurde mit der Alternativlosigkeit der Sachzwänge und gesellschaftlichen Entwicklungen erklärt. Doch vom “Durchregieren”, wie zu Zeiten als Oppositionsführerin, sprach die Kanzlerin nicht mehr. Stattdessen wurde von Merkel und ihren Beraterinnen das Wort in die Welt gesetzt, Merkel denke, weil sie Naturwissenschaftlern sei, die Dinge “vom Ende” her. Das unterscheide sie zum Beispiel von Schröder und anderen Männern.
Konservative Kritiker dieses Kurses der Einvernehmlichkeit in der eigenen Partei hatten sich wegen der Wahl–erfolge Merkels zu fügen, zumal sie politisches Führungspersonal nicht aufbieten konnten. Große Rücksichten auf das entsprechende Wählerpotenzial glaubten Merkel und ihre Gefolgsleute nicht nehmen zu müssen: Politisch rechts der Unionsparteien gab es – noch – keine Konkurrenz. Erst im Doppelpack von Euro-Rettungspolitik und der Flüchtlingsbewegung entstand die “Alternative für Deutschland” – gegründet vor allem von ehemaligen Merkel-Kritikern aus der CDU. Helmut Schmidt (mit den Grünen) und Gerhard Schröder (mit der Linkspartei) war es ebenso ergangen, dass eine neue Partei zum Erbe ihrer Kanzlerzeit wurde.
Merkels Nachfolger
Merkel aber verkörperte – und tut es immer noch – einen anderen Stil als ihre Vorgänger. Nicht polarisierend, sondern auf Konsens ausgerichtet tritt sie auf. Breitbeiniges Machogehabe männlicher Konkurrenz ist ihr fremd. Gleichbleibende Freundlichkeit kennzeichnet ihr öffentliches Auftreten. Merkels Erfolge prägten einen neuen Stil beim politischen Personal. In den Parteien und an den Spitzen der Landesregierungen kamen Politiker zum Zuge, die Merkel zu gleichen scheinen: an der Sache orientiert, Verbalinjurien vermeidend, beinahe beamtenhaft auftretend.
Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg) und Stephan Weil (SPD, Niedersachsen) stehen für den derzeit gefragten Typus deutscher Politiker. Auch nach dem Verzicht Merkels auf den CDU-Vorsitz setzten sich jeweils die Kandidaten durch, die Merkel am ähnlichsten sind: erst Annegret Kramp-Karrenbauer, dann Armin Laschet. Zwei Mal verlor Friedrich Merz als Vertreter des anderen Lagers. Einen schönen Nebeneffekt gab es auch: Vorwürfe und Kritik perlten an Merkel ab.
Eine Teflon-Kanzlerin? Erst als sich abzeichnete, dass sie nicht wieder als Kanzlerkandidatin antreten werde, wurden keine Rücksichten mehr genommen. Ab 2018 verlor sie innerparteilich an Autorität, verzichtete auf das Amt der Vorsitzenden, behielt aber als Regierungschefin genügend Fäden in der Hand. Nicht zu Unrecht wird Olaf Scholz, der aussichtsreiche SPD-Kanzlerkandidat, der nicht Parteivorsitzender ist, als sozialdemokratische Ausgabe der CDU-Bundeskanzlerin karikiert. Das Verhältnis der scheidenden Regierungschefin zu ihrem Vizekanzler und Finanzminister wird als gut beschrieben. Olaf Scholz versäumt es nicht, die enge Zusammenarbeit mit der Kanzlerin im Wahlkampf zu erwähnen. Aus dem Kampf um ihre Nachfolge hielt sich Merkel auf präsidiale Weise heraus, sodass die demobilisierende Frage berechtigt ist, wer ihr Lieblingsfavorit sei. Nur bei der Frage nach einem möglichen rot-rot-grünen Bündnis, das Scholz nicht explizit ausschließen will, rückte sie erstmals öffentlich von ihm ab. Also doch: erst das Land, dann die Partei?
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 136 – Thema: Die drei Fragezeichen – Wer wird die neue Merkel?. Das Heft können Sie hier bestellen.