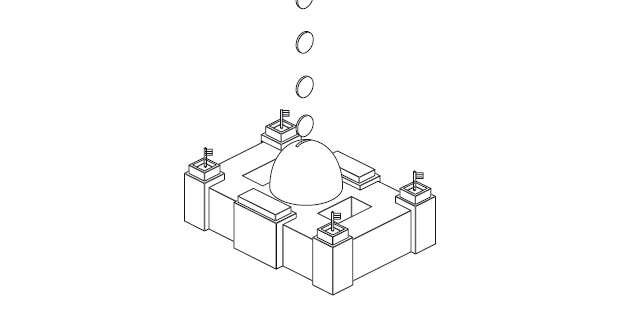Natürlich hat er die Zahlen im Kopf. Er ist ja studierter Diplom-Kaufmann. Aber wenn der Bundestagsabgeordnete Florian Post über seine privaten Wahlkampfkosten spricht, dann stellt er erst mal einen Vergleich an, den sich jeder Zuhörer gut merken kann. “Das ist schon der Gegenwert von drei Weltreisen”, sagt er. Um genau zu sein: Es waren 60.000 Euro. Sein ganzes Erspartes.
Posts Weltreisen führten ihn nicht nach New York, in die Antarktis oder in die Karibik, sondern nach Hasenbergl, in die Maxvorstadt und nach Schwabing. Der Sozialdemokrat wollte im Jahr 2013 den Bundestagswahlkreis München-Nord direkt erobern. Das war nicht ganz so aussichtslos, wie es im ersten Moment klingt. SPD-Legende Hans-Jochen Vogel hat es in den siebziger Jahren zweimal geschafft und Axel Berg in den Jahren 1998 bis 2009 sogar dreimal.
Der Wahlkreis München-Nord war schon immer so etwas wie das kleine gallische Dorf, das mitten in einem von Römern, sprich: Christsozialen, beherrschten Gebiet liegt. Doch trotz dieser Vorgeschichte wusste der 34-jährige Post, dass es für ihn schwer werden würde, denn seit 2009 hatte Johannes Singhammer (CSU) das Direktmandat inne und er trat erneut an.
Da entschied der junge Sozialdemokrat: wenn schon, denn schon. Er zog ein Jahr lang eine professionelle Kampagne mit Agenturkonzept durch und räumte seine Konten dafür ab. Damit dürfte er unter den 631 Bundestagsabgeordneten einer von denen sein, die am meisten eigenes Geld in den Wahlkampf investiert haben.
Christdemokraten investieren besonders viel
Im Durchschnitt setzen Christdemokraten 10.482 Euro aus der Privatschatulle ein, um ein Mandat zu erobern. Es folgen Sozialdemokraten (6.567 Euro), Grüne (1.937 Euro) und Linke (1.083 Euro). Diese Zahlen stammen aus der Kandidatenstudie 2013 (GLES) des Wissenschaftszentrums Berlin, die Professor Bernhard Weßels betreut hat.
Nicht alle Politiker sprechen gerne darüber, was sie sich den Wahlkampf kosten lassen. Sie fürchten, in eines der beiden Extreme zu geraten – also entweder von der Partei schief angesehen zu werden, weil sie so sparsam waren, oder unter den Kollegen manch kritischen Blick zu ernten, weil sie so hohe Summen investierten.
Philipp Lengsfeld geht offen damit um. Er kandidierte 2013 das erste Mal für die CDU in Berlin-Mitte. Hauptstädtischer geht es nicht. Im Wahlkreis liegt das Reichstagsgebäude. Schon sehr früh, sagt Lengsfeld, habe er mit seiner Partei über die Kostenfrage diskutiert. Am Ende lief das Wahlkampfbudget auf 25.000 Euro hinaus. Ein Drittel davon, also knapp 8.000 Euro, war der Eigenanteil des Bewerbers.
Der 43-jährige Physiker hätte zwar gerne über einen größeren Gesamtetat verfügt, aber wenn allzu hohe Summen vom Konto des Bewerbers stammen, findet er das nicht gut. Denn: “Es darf nicht am privaten Geldbeutel hängen.” Alles, was deutlich über 10.000 Euro hinausgeht, hält er für “nicht vertretbar”. Sonst wäre für manche Interessenten die Kandidatur kaum noch erschwinglich. Man müsse sich ja nur mal den Durchschnittsverdienst eines deutschen Arbeitnehmers ansehen, um das zu erkennen.
Die erste Kandidatur ist am schwierigsten
Philipp Lengsfeld lag am Ende knapp fünf Prozentpunkte hinter der Wahlkreissiegerin Eva Högl (SPD). Er denkt nicht, dass ein größerer Geldeinsatz das hätte umdrehen können. Das ist übrigens auch die Meinung aller befragten Politiker: “Kaufen” kann man sich ein Direktmandat in Deutschland auch mit noch so viel Aufwand nicht. Wenn überhaupt, dann ist es in knappen Wahlkreisen möglich, etwas zu bewegen.
Die Vertreter der kleinen Parteien haben eher selten die Chance, so nahe an ein Direktmandat heranzukommen. Deswegen geben sie in der Regel auch nicht ganz so viel Geld aus. Cornelia Möhring, Spitzenkandidatin der Linken in Schleswig-Holstein und Bewerberin in Pinneberg, beziffert den Eigenanteil in den beiden zurückliegenden Wahlkämpfen auf 4.000 beziehungsweise 5.000 Euro. Sie weist allerdings darauf hin, dass sie als Abgeordnete ihrer Partei im Jahr sowieso rund 25.000 Euro spendet.
Ähnlich ist es bei Markus Tressel von den Grünen. Er war Listenführer im Saarland und Direktkandidat in Saarlouis. Der 38-Jährige schätzt seine unmittelbaren privaten Wahlkampfausgaben – ohne die Abgaben an die Partei – auf 5.000 bis 10.000 Euro. Dass er etwas beisteuern würde müssen, war ihm von Anfang an klar. “Ich hab’ schon immer etwas draufgelegt”, sagt er, “selbst als ich für den Gemeinderat kandidiert habe.”
Am schlimmsten ist es für die Kandidaten, wenn sie zum ersten Mal antreten. Denn da sind die Wahlkreiskassen häufig leer. Vorgänger pflegen nicht immer etwas übrig zu lassen. Florian Post beziffert sein “Startkapital” auf etwa 400 Euro. Wer schon mal Abgeordneter war und für eine zweite Periode antritt, hatte dann wenigstens Gelegenheit, etwas anzusparen. Cornelia Möhring etwa legt monatlich 250 Euro dafür zurück.
Florian Pronold, SPD-Landesvorsitzender von Bayern und Staatssekretär im Bauministerium, führt seit mehr als zehn Jahren im Kreis Rottal-Inn ziemlich hoffnungslose Wahlkämpfe und räumt ein, dass er von einem Direktmandat “weit entfernt” sei. Trotzdem spendet er im Jahr 3.000 Euro in eine spezielle Unterbezirkskasse, was für den Wahlkampf dann 12.000 Euro ergibt. Beim ersten Mal, als frischgebackener Anwalt, hatte er kein eigenes Geld und musste sich auf das verlassen, was ihm die Partei zur Verfügung stellte.
Lokalblätter als wichtiger Faktor
Ein ganz wichtiger Faktor im Wahlkampf sei völlig kostenlos zu haben, fügt Pronold hinzu: die Berichterstattung in den Lokalmedien. Das eröffne auch Kandidaten mit weniger Geld gewisse Chancen (“Ich hätte das nie bezahlen können.”). Im Vergleich mit manchem Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters oder Landrats sei das, was Bundestagsabgeordnete ausgeben, ohnehin eher bescheiden. Da werde gerne auch mal das Doppelte ausgegeben.
Und lohnt es sich nun, private Mittel zu investieren? Auch bei dieser Frage hilft die Wissenschaft ein wenig weiter. Die bereits erwähnte Berliner Kandidatenstudie ergab am Beispiel der Wahl 2009, dass “sich die Wahrscheinlichkeit verändert, in den Bundestag gewählt zu werden, wenn die privaten Ausgaben zunehmen”. Von denen, die quasi nichts zuschossen, schafften es weniger als 20 Prozent ins Parlament. Stieg die Summe auf mehr als 16.000 Euro Eigenanteil, lag die Chance bei rund 60 bis 80 Prozent. Vielleicht geben aber auch nur diejenigen mehr aus, die von vornherein realistische Chancen sehen.
Der Münchner Florian Post lag zwar am Ende rund zwölf Prozentpunkte hinter dem Kontrahenten Johannes Singhammer und zog über die Liste in den Bundestag. Aber er bereut nichts. Im Gegenteil, er freut sich auf den Wahlkampf 2017. “Beim nächsten Mal rechne ich mir schon gute Chancen aus”, sagt er. Da wird wohl wieder die eine oder andere Weltreise nach Hasenbergl fällig werden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation III/2015 Geld. Das Heft können Sie hier bestellen.