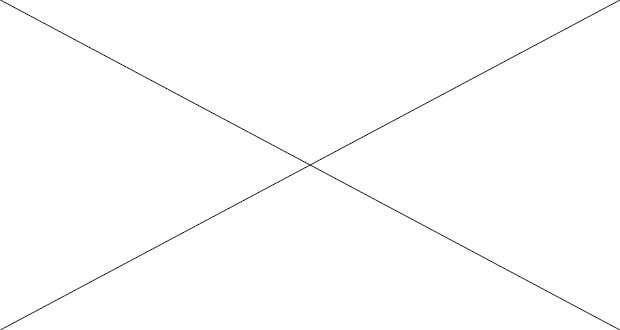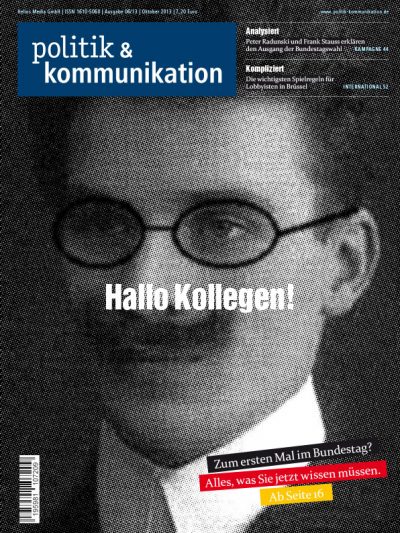Herr Movassat, herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl! Mussten Sie am Wahlabend lange zittern?
Nein, es gab ja vom WDR für die Linkspartei in NRW relativ bald eine Prognose von 6,5 Prozent. Und dann war es eigentlich klar.
Und wie fühlt man sich mit zwei Sternen im Kürschner?
Ich freue mich natürlich riesig über die Wiederwahl. Langsam fallen die Last und die Unsicherheit mit Blick auf den Wahlausgang von mir ab. Ich kann immer noch nicht ganz realisieren, dass der Wahlkampf jetzt zu Ende ist.
2009 wurden Sie erstmals in den Bundestag gewählt. Hatten Sie da sofort ein eigenes Büro?
Also, ich hatte nach zwei oder drei Wochen ein Büro im Gebäudekomplex „Unter den Linden 50“, das ich mir mit dem Linken-Abgeordneten Harald Weinberg geteilt habe. Das war jedoch nur ein Raum im Erdgeschoss, wo die ganze Zeit die S-Bahn vorbeidonnerte. Nach weiteren zwei Wochen hatte Harald sein Büro geräumt. Bis ich organisatorisch voll arbeitsfähig war, hat es circa drei Monate gedauert. Ich bin dann ja auch noch mal umgezogen, vom Erdgeschoss in den dritten Stock.
Und wann hatten Sie alle Mitarbeiter beisammen?
Ich habe gleich am Anfang eine Mitarbeiterin eingestellt, die das Dringendste für mich erledigte: Termine verwalten, E-Mails checken, Anrufe entgegennehmen. Meine beiden weiteren Mitarbeiter habe ich dann auch relativ schnell gefunden.
War es im Nachhinein eine kluge Entscheidung, die Leute so früh einzustellen?
Ich hatte das Glück, sehr kompetente Leute zu erwischen. Wenn ich allerdings noch mal neu in den Bundestag käme, würde ich einen Abgeordneten fragen, der schon länger dabei ist, ob er für einen Monat einen Mitarbeiter mit mir teilt. So ein Mitarbeiter-Sharing hat den Vorteil, dass man in Ruhe gucken kann, wen man einstellt.
Welche Tipps haben Sie noch für die Neulinge?
Ich würde jedem empfehlen, schnell die Stelle des Sachbearbeiters zu besetzen. Einfach weil dann alle Organisationssachen erledigt werden. Außerdem ist es für die Besetzung dieser Stelle ja nicht nötig, schon zu wissen, in welchen Ausschuss man letztlich kommt. Anders verhält es sich bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die ja vor allem inhaltlich zuarbeiten. Da sollte man erst die Entscheidung über den Ausschuss abwarten, um dann Leute einzustellen, die sich in diesem Politikfeld auskennen. Es wird einem auch keiner krumm nehmen, wenn man im Dezember nicht schon seine erste Rede im Plenum gehalten hat.
Wann haben Sie denn im Plenum zum ersten Mal am Rednerpult gestanden?
(überlegt kurz). Im Dezember 2009 (lacht). Gesprochen habe ich zur Piraterie in Somalia. Das war damals ein öffentlich heiß diskutiertes Thema, vor allem in den Medien. Entsprechend nervös war ich.
Und apropos Ausschuss: Sie wollten 2009 eigentlich in den Rechtsausschuss, sind am Ende aber im Entwicklungshilfeausschuss gelandet. Ärgert Sie das heute noch?
Nein. Ich bin Jurist und habe vor vier Jahren gedacht, der Rechts- oder Innenausschuss wäre ganz interessant. Doch im Nachhinein muss ich sagen, dass ich sehr froh bin, nicht in meinen damaligen Wunschausschuss gekommen zu sein. Rechtspolitik ist ja doch eine sehr trockene Materie und in der Öffentlichkeit schwierig zu vermitteln. In der Entwicklungspolitik sind die Themen viel lebensnäher. Außerdem gibt es auch dort rechtliche Fragen zu klären. (lacht)
Blöd nur, dass Sie vorher mit diesem Politikfeld nichts am Hut hatten.
Das stimmt, nur am Rande durch die bei den Linken sehr wichtige Friedenspolitik. Aber klar: Ich kam ja aus der Landespolitik und hatte mich dort vorher vor allem mit jugendpolitischen Themen beschäftigt.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie richtig drin waren in der Entwicklungspolitik?
Zu einigen Themen kann man schon nach zwei bis drei Monaten etwas Vernünftiges sagen. Aber bis man wirklich einen richtigen Blick auf alles hat und die Zusammenhänge versteht, dauert es ein Jahr.
Sie waren 25 Jahre alt, als Sie 2009 in den Bundestag eingezogen sind. Wie stark wird man als junger Bundestagsabgeordneter auf sein Alter reduziert?
Jeder, der neu im Bundestag ist, muss sich erstmal beweisen. Sicher stehen jüngere Abgeordnete unter besonderer Beobachtung, weil sich manche Kollegen insgeheim fragen: Haben die überhaupt schon mal gearbeitet? Noch dazu ist die Wahrscheinlichkeit, dass man als jüngerer Abgeordneter vom Wachpersonal nach seinem Ausweis gefragt wird, höher als bei den älteren Kollegen. Aber ich bin ja jetzt wieder der jüngste Abgeordnete der Linken. Insofern weiß ich schon, was mich erwartet.
Nicht nur die Kollegen sind älter, sondern meistens auch die Mitarbeiter. Wie kamen Sie mit der Chefrolle zurecht?
Daran musste ich mich erst gewöhnen. Man kandidiert ja als Abgeordneter und nicht als Arbeitgeber. Meine Erfahrung ist: Es ist für das Team nicht gut, wenn man gar keine Ansagen macht. Ganz nach dem Laissez-Faire-Prinzip klappt es nicht. Aber es hilft auch nichts, alles kontrollieren zu wollen. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter haben in den Details meist mehr Fachwissen als man selbst.
Wie haben Sie die bisherigen vier Jahre im Bundestag verändert?
Meine Freundin sagt immer, dass ich mich nicht groß verändert habe. Ich selbst denke, dass ich ein bisschen ernster geworden bin und auch ein Stück politischer. (lacht) Wenn Politik der Hauptberuf ist, dann nimmt man etwa die Nachrichten ganz anders wahr.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Hallo Kollegen. Das Heft können Sie hier bestellen.