Zitate-Raten ist eine lehrreiche Freizeitbeschäftigung für historisch Interessierte. Vermutlich würden die meisten Akteure des Berliner politisch-medialen Komplexes sie dem trockenen Konsum von kommentierten Redensammlungen vorziehen. Ein aber für beide Aktivitäten gut geeigneter Kandidat wäre Walter Scheel. Der hielt nämlich ungewöhnlich gute Reden – Person wie Texte fielen jedoch weitestgehend dem Vergessen anheim. Insofern garantiert die Lektüre Erkenntnisgewinn, der sich wiederum in stete Ratespielerfolge ummünzen ließe.
Dass der 8. Mai 1945 nicht nur “Niederlage”, sondern auch “Befreiung” bedeutete, ordnen die meisten Deutschen Richard von Weizsäcker zu. Und tatsächlich war die Formulierung vom “Tag der Befreiung” in ihrer Eingängigkeit der tragende Gedanke dessen Rede anlässlich des 40. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges. Den Satz samt Autor (oder zumindest Rhetor) kennen sogar jüngere Menschen. Die wenigsten wissen hingegen noch, wer Walter Scheel war.
Indes: Die Einordnung des 8. Mai als “Befreiung” stammt von Walter Scheel. Fällt heute sein Name, ist die häufigste Assoziation “Hoch auf dem gelben Wagen” – und zwar nicht, weil die Liberalen mit dem als rheinische Frohnatur Verschrienen an der Parteispitze zu großen politischen Erfolgen gerollt waren. Sondern weil es mittlerweile absonderlich anmutet, dass ein Politiker mit einem Volkslied eine Platin-Schallplatte “ersingt”.
Die Beschäftigung mit Walter Scheel lohnt allerdings weniger, weil sich einige skurrile Sentenzen der Bonner Republik auftun lassen, die für “Treibhaus”-Nostalgiker geradezu als Synonym für deren gesamte kulturelle Verfasstheit fungieren. Vielmehr steht seine Biographie paradigmatisch für die Geschichte der ersten 30 Jahre der Bundesrepublik Deutschland. Genauso spiegeln die Reden des herausragenden Rhetorikers diesen Zeitabschnitt und die Verortung des Landes am Rhein wider. Hierhin eine Zeitreise zu unternehmen, lohnt sich textlich wie auf Bildern; Scheel war ein überaus fotogener Charakterkopf, von dem viele eindrucksvolle Fotografien existieren.
Beeindruckende Karriere
Seine Karriere in öffentlichen Ämtern ist beeindruckend, zumal Scheel dabei alle Stufen in jungen Jahren, manche als bis dahin Jüngster, erklommen hatte: Parlamentarier auf allen vier Ebenen, auf kommunaler, als Abgeordneter im Landtag von NRW und im Deutschen Bundestag sowie im Vorläufer des Europaparlaments. Erster Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit im letzten Kabinett von Bundeskanzler Konrad Adenauer und anschließend in der Regierung von Ludwig Erhard. Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Bundesvorsitzender der FDP, Außenminister in der sozialliberalen Koalition, schließlich Bundespräsident.
Allein im letzten Amt hielt er an die 250 Reden, viele davon sind bestens erhaltene Zeugnisse liberaler Haltung und offenen Denkens, dabei für seine Mitmenschen oftmals unbequem. Editionswürdige Texte aus der Zeit davor sind zum Teil politische Gebrauchsreden, die Zeugnis von der Geschichte der Bundesrepublik ablegen, zum Teil leidenschaftliche Bekenntnisse, wie man sie sich heute häufiger im Bundestag wünschte. Manche sind beides, wie seine eher kurze Ansprache in der Parlamentsdebatte vor dem Konstruktiven Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Willy Brandt Ende April 1972.

Scheel bezieht 1974 das Bundespräsidialamt und schreitet die Ehrenkompanie des Bundesgrenzschutzes ab. (c) J. H. Darchinger
Hier zog der Juniorpartner Bilanz der gemeinsamen Regierungszeit. Die Dramatik der Situation und die emotionale Wucht der Worte erschließen sich selbst auf dem Papier unmittelbar. Als Gedankenexperiment stelle man sich einmal vor, wie heutzutage Vizekanzler Olaf Scholz – oder gar Heiko Maas oder das SPD-Vorsitzenden-Duo Eskabo – als kleiner Koalitionspartner offensiv-stolze Bilanz der gemeinsamen Regierung mit Angela Merkel zöge. Nun gut, früher war sowieso alles besser, insbesondere für die SPD.
“Kritische Sympathie”
“Miteinander, nicht gegeneinander”, lautete dann 1974 die Leitidee, mit der Scheel seine Präsidentschaft überschreiben wollte. Ein Motto, wie sie ähnlich einige seiner Nachfolger wählten. Indes, es kam anders. Die Republik steuerte in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre auf schwere Zeiten zu. Zwei der bedeutendsten bundespräsidialen Reden Scheels stehen im Kontext der terroristischen Bedrohung, beide aus dem Oktober 1977: Zunächst anlässlich der 500-Jahr-Feier der Universität Tübingen, wo er zur “kritische Sympathie des Bürgers mit dem demokratischen Staat” aufrief – ebenfalls ein Thema, bei dem viele sagen würden: aktueller denn je. Mag das aus historischer Perspektive fraglich scheinen, ist auf jeden Fall heute noch richtig, was Scheel vor über 40 Jahren formulierte:
“Eine Demokratie ist immer auf dem Wege zu sich selbst. Sie ist nie fertig. Nur Staaten, in denen die Freiheit nicht viel gilt, behaupten von sich, sie hätten das Klassenziel erreicht. Nur Menschen, die von Freiheit nichts wissen, behaupten, sie hätten ein Rezept, wie der ‘ideale Staat’ zu verwirklichen sei. Freiheit und unvollkommener Staat, das gehört zusammen – ebenso wie der ‘ideale’ Staat mit Unfreiheit und Unmenschlichkeit zusammen geht. Die Demokratie ist nicht zuletzt deshalb die beste Staatsform, weil sie sich ihre eigenen Mängel eingesteht.”
Dann seine Worte auf der Trauerfeier für den von der RAF ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer. Dort bat das Staatsoberhaupt die Angehörigen um Vergebung. Nicht nur, dass der Bundespräsident – gegen den Rat seiner Mitarbeiter – in dieser Ansprache die Dialektik von Verantwortung und Schuld des Staates klar benannte, war an ihr bemerkenswert. Sondern Scheel vermochte es auch, über den Begriff der Scham die Täter, die sonst vielfach nur als entmenschlichte Wesen galten, als Mitmenschen zu adressieren – eine Haltung, die damals nicht alle Deutschen geteilt haben dürften.
Richtige Worte, aber zu früh
Politische Reden müssen in ihrer Zeit gelesen werden. Überdeutlich wird dies anhand der eingangs genannten Ansprache Scheels zum 30. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges. Es gibt diverse Gründe, warum sie anders als ihr Pendant zehn Jahre später nicht in das historische Gedächtnis unseres Landes einging. Im Vergleich ermangelte es ihr etwas an sprachlicher Griffigkeit, sie wurde präsidialamtsseitig weder inszeniert noch anschließend beworben. Zudem kann Erinnerung schmerzen – vor allem wenn die Rezipienten das Erinnerungswürdige selbst erlebt, erlitten oder vielleicht sogar daran mitgewirkt haben. So gesehen kam die Rede mit ihrer klaren Verantwortungszuweisung zu früh.
Dass im vergangenen Jahr anlässlich des 75. Jahrestages diskutiert wurde, inwieweit die Deutung des 8. Mai 1945 als Befreiung es den Deutschen erlaube, sich bequem in die Riege der Opfer des Nationalsozialismus einzureihen, belegt einmal mehr, wie sehr Gedenkpolitik Zeitströmungen unterworfen ist. In der Hinsicht hatte Scheel den Nachgeborenen eine Erkenntnis von zeitloser Schönheit mit auf den Weg gegeben, heute möglicherweise nötiger denn je: “Es ist leichter, ein guter Demokrat zu sein, wenn man in gesicherten demokratischen Verhältnissen aufwächst.”
Das Attribut “zeitlos” passt ebenfalls auf den Parteipolitiker Walter Scheel. In dieser Kategorie lässt sich erstaunlich viel Modernes zu Tage fördern – seine Reden zu den jeweiligen Anlässen zeugen davon: In den legendären, gut konservierten „Freiburger Thesen“ von 1971 ein eigenes Kapitel zur Umweltpolitik – Premiere im Programm einer deutschen Partei. Die koalitionspolitische Offenheit, die sich die FDP mit Hilfe Scheels zunächst in Nordrhein-Westfalen und dann auf Bundesebene zulegte. Die Bedeutung des Themas Bildung, verbunden mit der liberalen Indienstnahme intellektueller Kaliber wie Ralf Dahrendorf.
“Wir sind nicht nur Opposition”
Als Vorsitzender sorgte Scheel, persönlich an Programmatik eher mäßig interessiert, zumindest für Personal, das den Anspruch seiner Partei inhaltlich füllen konnte: “Wir sind nicht nur Opposition, sondern wir sind die liberale Partei in Deutschland”, hieß es in seiner Antrittsrede im Januar 1968. Das politisch einzulösen, fiel allerdings schon damals unter den Bedingungen der allerersten Großen Koalition selbst als alleinige Oppositionspartei schwer.
Eine letzte Kategorie, in der Scheel inspirierend für die heutige Politikgestaltung sein kann, ist die symbolisch-zeremonielle Ebene. Der den Menschen freundlich zugewandte Diplomat, der sich auf Tapetentüren verstand, hatte etwas übrig für Repräsentation. Diese in der Bundesrepublik aus historischen Gründen unterbelichtete Disziplin ist zugegebenermaßen schwerlich aus Redetexten herauszulesen. Einfangen lässt sich hingegen die Fertigungstiefe der Ansprachen, jenseits der polierten Oberfläche, die für viele bundespräsidiale Reden typisch ist. Und Protokoll ist eben mehr als nur schöner Schein.
Den wiederum suchte Scheel nach dem Ausscheiden aus seinen staatsoffiziellen Ämtern etwas zu sehr – was mit ursächlich dafür sein dürfte, dass er in Vergessenheit geriet. Nicht vollkommen frei von Mitnahmeeffekten zu sein, war für die bundesrepublikanische Aufstiegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg wohl bei denen, die konnten, durchaus gängig. Gegen Ende der Bonner Republik wurde dieser Charakterzug zunehmend von einem Hauch der Tragik umflort. Hinsichtlich dessen sorgten in seinen letzten Lebensjahren bestenfalls exzentrisch zu nennende Auftritte der dritten Ehefrau für Aufsehen. Doch der Politiker Walter Scheel, von Arnulf Baring einst als “Mr. Bundesrepublik” bezeichnet, war da schon längst Geschichte. Seine Reden aber leben fort.
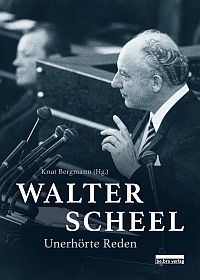
Mit Essays von Knut Bergmann, Ewald Grothe und Gundula Heinen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 134 – Thema: Wahlkampffieber – Superwahljahr im Zeichen der Pandemie. Das Heft können Sie hier bestellen.



















