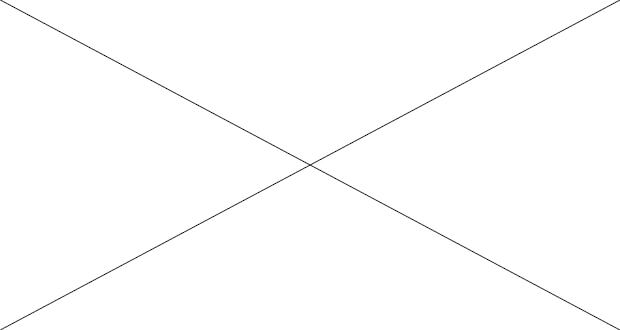Keine Frage. Barack Obama ist derzeit das Gesprächsthema Nummer eins, wenn es um Wahlkampf und Kommunikation geht. Und dies nicht nur in den USA, sondern weltweit. Spätestens mit seinem Auftritt vor über 200.000 Menschen in Berlin hat die Obamania eine globale Dimension erreicht, und auch die deutsche Politik stellt sich ganz sicher die Frage, wie sie selbst im kommenden Jahr auch nur annähernd ähnliche Mobilisierungen vollbringen kann.
Obama bietet eine komplexe Mischung aus empfundener Authentizität, Emotionalität, immensen Geldsummen, hochprofessonieller Inszenierung und Kampagnenstrategie sowie einem Medienhype, wie ihn die Nation und auch Europa selten erlebt haben. Die Ursachen dafür scheinen auf der Hand zu liegen: Die persönliche Geschichte Barack Obamas, seine Rhetorik, sein kometenhafter Aufstieg zum Spitzenreiter im Kampf um das Präsidentenamt sind außergewöhnlich.
Doch es sind nicht nur die Person und das Charisma Obamas, die Wahlkampfexperten auf beiden Seiten des politischen Spektrums herausstreichen, wenn man sie nach den Erfolgsfaktoren des Demokraten fragt. Auch in puncto Kampagnenführung zollen ihm viele Experten Respekt. Kaum ein Kandidat in der Geschichte der USA verfügte über ein solches Heer von Freiwilligen; über eine so professionelle Fundraisingmaschine und über eine Botschaft, die sich so nahtlos in den Zeitgeist einfügt.
Ein nüchterner Blick auf die jüngsten Umfragen lässt aber erahnen, dass Obama noch viel Arbeit und etliche Unwägbarkeiten vor sich hat. Nur knapp liegt er noch vor John McCain, der es schafft, sich mit seinem unabhängigen Politikstil und seiner persönlichen Lebensgeschichte von den düsteren Umfragewerten seiner Partei und seines Präsidenten zu distanzieren. Wie seine jüngsten Attacken zeigen, wird der politische Haudegen McCain seinem Konkurrenten das Feld nicht kampflos überlassen.
Antithese zu George W. Bush
Dass Obama aber auch heute noch als Favorit im Rennen um das Präsidentenamt gilt, dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe: Erstens bewegt er sich im richtigen Message-Frame. Das Land ist müde von der Präsidentschaft George W. Bushs, dessen Zustimmungsraten stabil unter 30 Prozentpunkten liegen. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Obama, weil er per se als Antithese zum jetzigen Präsidenten wahrgenommen wird. Zudem stehen mit Wirtschaft und Arbeit, Energie und Gesundheit Themen oben auf der Agenda, auf denen die Wähler Obamas Kompetenzen prinzipiell höher einschätzen als die McCains. Auch wenn viel Kritik an Barack Obama geübt worden ist, weil er seine Kampagne an Meta-Begriffen wie „Unity“, „Hope“ und „Change“ ausrichtet, so hat der junge Senator aber ein kommunikatives Dach, eine große Erzählung für seine Kampagne gefunden, die den Zeitgeist trifft.
Zweitens hat Obama eine beeindruckende Basisorganisation aufgebaut. Schätzungen von Insidern zufolge wird er am Ende des Wahlkampfs acht bis zehn Millionen Freiwillige aktiviert haben, die für ihn Wahlkampfveranstaltungen, Telefonkampagnen und Hauspartys organisiert haben. Schon jetzt ziehen Woche für Woche Abertausende von Freiwilligen von Haus zu Haus, um unentschlossene Wähler von der Kandidatur Obamas zu überzeugen. Mit dieser unglaublichen Zahl von Volunteers, der viralen Kraft des Internets und gut gemachten Direct- Mails wird Obama das neue Wahlkampfcredo: „Je persönlicher ich kommuniziere, desto effektiver verankere ich meine Botschaft“ auf eine neue Stufe heben.
Wie Thomas Gensemer, Geschäftsführer von Obamas Internetberatung Blue State Digital berichtet, suchen die Kampagnenexperten gezielt nach gesellschaftlich gut vernetzten Meinungsführern, die Informationen authentisch und direkt in ihre sozialen Netzwerke hineintragen. Über das Portal my.barackobama.com, das vom Facebook-Gründer Chris Hughes geleitet wird, ist eine Form des Aufbaus von Communitys möglich, die durch ihre Verschränkung von Online- und Offline-Dialogaktivitäten in den kommenden Monaten für erstaunliche Mobilisierungserfolge sorgen wird.
Aber auch John McCain verfügt über ähnliche Instrumente, sie stehen nur weniger im Fokus des öffentlichen Interesses. Er kann auf die intakte und eingeübte Basisorganisation des Republican National Committee zurückgreifen und auch mit dem Relaunch seines Internetportals www.johnmccain.com setzt er die neuen Maximen der Peer-to-Peer-Kommunikation sehr gut um. Das löst allerdings nicht sein Grundproblem: Seiner Kampagne fehlt schlichtweg die Energie einer begeisterten Basis, Enthusiasmus, entfacht durch einen charismatischen Kandidaten, und die richtige Botschaft.
Finanzielle Vorteile
Drittens hat Barack Obama deutliche finanzielle Vorteile gegenüber John McCain. Befreit von den Ausgabenobergrenzen der öffentlichen Wahlkampffinanzierung wird er nach Expertenmeinungen bis zum Wahltag 300 bis 400 Millionen Dollar auf seinen Konten verbuchen. Sein Spendernetzwerk greift schon jetzt mit über zwei Millionen Geldgebern weit in die Gesellschaft hinein und kann in regelmäßigen Abständen immer wieder aktiviert werden, ohne dass die Einzelspender ihre Obergrenze von 2.300 Dollar ausreizen. John McCain kann mit dieser Fundraisingmaschine oberflächlich betrachtet nicht mithalten. Zählt man aber die Ressourcen des Republican National Committee und anderer parteinaher Interessengruppen zum Budget McCains dazu, wird auch er auf eine Summe von über 200 Millionen Dollar kommen. Das reicht, um wettbewerbsfähig zu bleiben, beinhaltet aber ein großes Problem. Laut Gesetz darf McCain seine Kommunikationsstrategie nicht mit Partei und außenstehenden Gruppen koordinieren. Obama ist dagegen finanziell vollkommen autark, er kann seine Themenagenda autonom kontrollieren und führt Gelder zudem direkt in die regionalen Parteiorganisationen weiter.
Zwar ist noch alles offen, doch ist durchaus eine Tendenz auszumachen: Advantage Obama. Dessen zwei größte Probleme bleiben: Über-Popularität und McCains Attacken. Zum einen muss der Politstar aufpassen, dass er die Schraube der Masseneuphorie und der Inszenierung nicht zu weit dreht und dabei die von Amerikanern sehr geschätzte Bodenhaftung scheinbar verliert. Schon einmal im Laufe dieses Wahlkampfs hat ihm seine Hyper-Popularität geschadet. Viele bodenständige Kleinstädter in Ohio und Pennsylvania fanden den Starrummel um Obama abgehoben und suspekt. Sie wählten mehrheitlich Hillary Clinton. Zum anderen hat John McCain unter der Leitung seines neuen Kampagnenchefs Steve Schmidt nunmehr eine einheitliche Angriffslinie gegen Obama gefunden und die lange Phase des Lavierens ohne klare Kontur beendet. Schmidt, ein erfahrener Berater, der unter Karl Rove das Rapid-Response-Team der Bush-Kampagne geleitet hatte, verordnete der McCain-Kampagne mehr Disziplin und Schlagkraft. Er will Obama als elitären Superstar darstellen, dem es primär um die Förderung seiner eigenen Karriere und nur sekundär um das Wohl des Landes geht. Auch wenn McCain noch im Frühsommer versprochen hatte, eine respektvolle Kampagne führen zu wollen, so sieht es doch jetzt nach einem klassischen Kontrastwahlkampf aus. McCain möchte das Rennen zu einer Charakterfrage zwischen ihm und Obama machen. Das ist schlau, denn so isoliert er den Wahlkampf von Negativstimmungen gegenüber der Republikanischen Partei und ihrem unbeliebten Präsidenten. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob diese Rechnung aufgeht.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe wir wollen rein – Bundestag 2009. Das Heft können Sie hier bestellen.