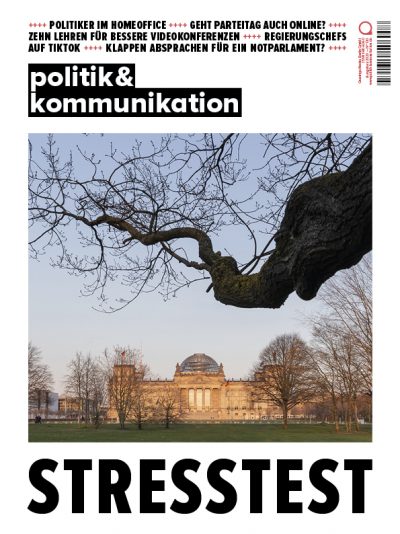Christian Drosten hat sich zu Beginn der Corona-Krise offenbar tüchtig geärgert. Die Pressekonferenzen zur Pandemie habe er als “Zeitverschwendung empfunden”, sagte der mittlerweile bundesweit bekannte Chef-Virologe der Berliner Charité dem NDR. “Ich wurde nur nach leeren Fußballstadien und dem CDU-Parteitag gefragt, anstatt inhaltliche, medizinische Fragen zu beantworten.” Der politische Journalismus müsse “zurückgefahren” werden zugunsten des Wissenschaftsjournalismus. Mehr erklären, weniger kritteln, so klang es. Das war Anfang März. Seinerzeit wurde in Deutschland teilweise noch vor Publikum gekickt. Der CDU-Parteitag war noch nicht abgesagt. Überhaupt hatte die Pandemie längst noch nicht die verheerenden Ausmaße angenommen, die sie heute hat. Stattdessen war von Panikmache die Rede.
Unterdessen sind die Fragen an Drosten und weitere Experten anders geworden, existenzieller. Nach dem CDU-Parteitag fragt kein Mensch mehr. Die Fußball-Bundesliga dürfte Drosten zufolge erst im nächsten Jahr zur Normalität zurückkehren können; die Vereine kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Von Belang ist höchstens noch der Hahnenkampf zwischen manchen Ministerpräsidenten, wer die schwersten Geschütze gegen das Virus auffährt. In jedem Fall hat sich durch die Krise auch für den politischen Journalismus einiges verändert – zum Guten wie zum Schlechten.
Zunächst einmal sind die meisten Journalisten wie große Teile der Republik ins Homeoffice gezwungen. Internetseiten werden ohnehin zu Hause mit “Content” befüllt. Aber auch ganze Zeitungen werden in diesen Tagen von ausgewachsenen Redaktionen daheim produziert. Lediglich Druck und Vertrieb (E-Paper selbstredend ausgenommen) bleiben zwangsläufig analog. Hier erweist sich die fortschreitende Digitalisierung als Segen. Was für Verlage gilt, gilt in ähnlicher Weise für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Ins ARD-Hauptstadtstudio beispielsweise kamen jedenfalls bis zuletzt nur jene Mitarbeiter, die an aktuellen Beiträgen beteiligt waren. Der Rest wurde jeweils gebeten, in den eigenen vier Wänden zu verharren.
Es geschieht kaum noch etwas
Das alles ist auch deshalb kein großes Problem, weil ja “draußen im Lande” kaum noch etwas geschieht, was sich covern ließe, und Termine flächendeckend ausfallen. Pressekonferenzen – unlängst zum Beispiel die zur Polizeilichen Kriminalstatistik – werden reihenweise abgesagt, Sitzungen ebenfalls, Hintergrundgespräche sowieso. Die Recherche findet mit Hilfe von Smartphones, Messenger-Diensten und E-Mails statt, basierend auf dem Material der Nachrichtenagenturen, die Deutsche Presse-Agentur vorneweg. Das alles ist sehr schnell sehr normal geworden – auch wenn es der Medienjournalist Daniel Bouhs mit Recht “schon ein bisschen seltsam” findet, “dass man gar nicht mehr vor die Tür geht”. Immerhin müsse ja unter anderem überprüft werden können, ob existierende Ausgangsbeschränkungen eigentlich eingehalten würden, sagt er.
Jenseits dieser praktischen Seite hat die Corona-Krise für den politischen Journalismus aber noch weitere neue Aspekte – und zwar sehr viel weitreichendere. Fraglos positiv ist das gestiegene Interesse an fundierten Informationen. Die Nutzerzahlen im Netz explodieren regelrecht. Die Menschen wollen wissen, was los ist. Und das, was sie wissen wollen, ist teilweise (über)lebensnotwendig. Journalismus gilt da mehr denn je als das, was er ist: als systemrelevant. Viele Menschen – oft selbst im Homeoffice – haben auch mehr Zeit als sonst, Nachrichten zu konsumieren. Dieser für viele Verlage nicht zuletzt ökonomisch wichtigen Entwicklung dürften bei fortschreitender Wirtschaftskrise allerdings Einbußen im Anzeigengeschäft ebenso gegenüber stehen wie die vermehrte Kündigung von Abonnements und die nachlassende Bereitschaft, für Inhalte im Netz zu bezahlen. Letzteres zeigen Appelle, Krisen-Berichterstattung doch von der Paywall zu befreien. Das wiederum droht journalistische Leistungsfähigkeit mittel- und langfristig zu gefährden.
Medien müsse unterstützen – mehr nicht
Weiter gewachsen ist neben dem Informationsbedürfnis der Konsumenten gewiss auch das Bewusstsein der Journalisten für die eigene Verantwortung. So schrieb der Blogger Richard Gutjahr bei Twitter, er empfinde die Berichterstattung, “egal ob Online, TV, Hörfunk oder Print, in Anbetracht der außergewöhnlichen Lage als überaus professionell und angemessen”. Gutjahr widersprach damit seinem künftigen Chef Gabor Steingart, der mediale “Erregungsfabriken” am Werke sah. In dem, was Gutjahr schreibt, liegt eine echte Chance: die mitunter und vielfach zu Unrecht ramponierte Reputation des politischen Journalismus insgesamt aufzupolieren. Diese Chance wird lediglich begrenzt durch die nicht wenigen Zeitgenossen, die ein Übermaß an schlechten Corona-Krisen-Nachrichten bloß bedingt ertragen – und statt nach harten News nach Zerstreuung suchen.
Mindestens ambivalent ist, dass es den Medien als Kontrollinstanz im Augenblick ein bisschen so geht wie der Opposition im Bundestag und in den Länderparlamenten: In einer Krise bisher nicht dagewesenen Ausmaßes kann und muss die Exekutive binnen kürzester Zeit Entscheidungen fällen, die jede für sich genommen von enormer Tragweite sind, in der Vergangenheit unvorstellbar waren und nun binnen Wochen alle auf einen Schlag getroffen werden müssen – von Schulschließungen und Ausgehverboten bis hin zu einer rapiden Neuverschuldung. Vieles führt in rechtliche, auch in verfassungsrechtliche Grenzbereiche. Nichtsdestotrotz sind Opposition und Medien überwiegend zu affirmativem Verhalten verdammt.
Immer weniger Platz für kritische Nachfragen
Der Vorsitzende der Bundespressekonferenz, Mathis Feldhoff, sagt denn auch: “Wir haben das erste Mal in unserer 70-jährigen Geschichte Pressekonferenzen einschränken müssen. Das ist ein tiefer Einschnitt in unser Verständnis von freier Berichterstattung. Wir sind der Ort, an dem der Regierung jede Frage gestellt werden kann, an dem kritischer Journalismus zu Hause ist. Diese Krise stellt dieses Selbstverständnis ganz praktisch infrage.” Tatsächlich finden bereits geplante Pressekonferenzen teilweise nicht statt; bei denen, die stattfinden, wird der Zugang begrenzt, damit ein Mindestabstand zwischen den Journalisten gewahrt werden kann – so wie bei den Pressekonferenzen Angela Merkels auf der gegenüberliegenden Straßenseite, im Kanzleramt. Unvorstellbar, dass Journalisten jetzt dicht an dicht vor Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sitzen, wie sie das am 11. März noch getan haben. Das scheint eine Ewigkeit her zu sein.
Der Normalzustand auch in Corona-Zeiten wäre ja eine kritische Begleitung jeder einzelnen Anti-Krisen-Maßnahme. Der Normalzustand wäre ferner eine breite Debatte mit kontroversen Positionen – von Politikern artikuliert, von Medien transportiert, strukturiert und gelegentlich zugespitzt. Der Normalzustand wäre schließlich, dass der eine oder andere Schritt auf entschlossenen Widerstand stoßen und eben nicht umgesetzt würde. Nichts davon findet derzeit wirklich statt. Während die Krise größer wird, werden der Raum für kritisches Nachfragen und der Meinungspluralismus zwangsläufig kleiner. Dies ist – da es um Leben und Tod und den Kollaps ganzer Gesellschaften geht – unvermeidlich und “alternativlos”. Auch wenn es dabei um die Gesundheit geht: Gesund ist das für eine demokratische Gesellschaft – und Medien sind integraler Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft – auf Dauer trotzdem nicht. Das dürfte auch Christian Drosten so sehen.
Der Fachmann von der Berliner Charité, den Anfang des Jahres noch niemand kannte, kommuniziert übrigens heute vielfach selbst und direkt mit einem interessierten Publikum – vorzugsweise via Twitter, wo er Anfang April bereits 157.000 Follower hatte. Einen seiner Tweets leitete Drosten unlängst mit vier Worten ein, die trotz aller Dramatik Sinn für Humor offenbarten. Die vier Worte lauteten: “Liebe Freunde der Virologie.”
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 130 – Thema: Stresstest. Das Heft können Sie hier bestellen.