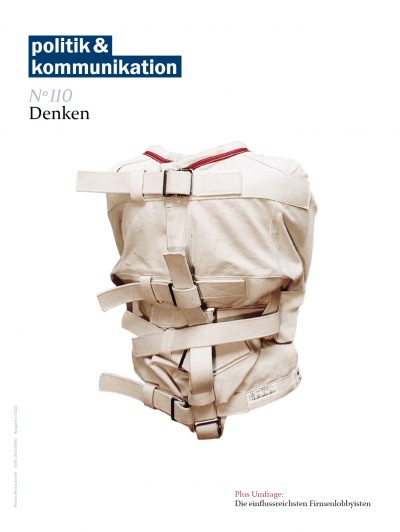Vor 20 Jahren wurde die “Renaissance der Salonkultur” ausgerufen. Nicht nur, aber besonders in Berlin. Mit dem Regierungsumzug kreiste bald auch die politische Kommunikation um das Format Salon. Begegnungen im Neuberliner Flair sollten Altbackenes aus Bonn ersetzen. Es galt, Geselligkeit und Gedankenaustausch mit Stil, Ambiente und Exklusivität zu koppeln und als Hommage an die Historie zu verpacken: die Tradition als “Hauptstadt der Salons”, ein Erbe der Aufklärung und der Kulturgeschichte Europas.
Der Zeitgeist der neunziger Jahre rief gern die Namen jüdischer Salonnièren wie Henriette Herz und Rahel Levin Varnhagen auf, die genau 200 Jahre zuvor in Berlin Gäste zum gebildeten Teekränzchen luden, die sonst nie ebenbürtig verkehrten: Adel, Hofbeamte und bürgerliche Kaufleute, Gelehrte und Dichter, Aus- und Inländer, Christen und Juden, Herren und Damen. Das Politische an dieser lockeren Zusammenkunft im privaten Zuhause war, dass sie keine Rücksicht nahm auf Rang, Stand und Geschlecht. Aber waren es politische Salons? Ja und nein.
Canapés und Zeitkritik
In frühen Salons war die politische Plauderei genehm: als kleiner Streifzug mit Zeitkritik, Tiefsinn, empfindsamem Witz und Aperçus. Der parteiische Streit war partout tabu. Zum Canapé servierte man keine unverdaulichen Konflikte. Agitation war ungalant. Die “Republik des freien Geistes” im frühen Salon war prekär und ging nie so weit, Junker und Jakobiner ideell Klingen kreuzen zu lassen. Ein Debattierklub passte nicht zur Damenregie. Sie blieb der Harmonie unter den Habitués (Stammgästen) und der Ästhetik schöngeistig verfeinerter Gesprächskunst verpflichtet.
Anders als in Paris, wo Salons Brutstätten der Parteien waren, blieb der Einfluss deutscher Salons aufs politische Handeln schwach. Der Soziologe Jürgen Habermas idealisierte sie als neuartige Öffentlichkeit, Feministinnen sahen sie, weil weiblich geführt, als Vorstufe der Frauenbewegung. Etwas Skepsis ist aber geboten.
Die Politisierung kam in Wellen. Als Napoleon 1806 Preußen unterwarf, entstanden patriotische Salons, die vielfach von Frauen geführt wurden. Dort wurde es bisweilen lauter, man schwelgte in empörtem Nationalgefühl und wähnte sich als vaterländische Widerstandszelle. Der Salon der Gräfin Luise von Voß etwa heckte Pläne zur Volkserhebung aus und trieb Fundraising für eine glücklose Guerillatruppe. Deutsch-tümelnde Kreise verfielen dem Fremden- und Judenhass. Das Salonklima wurde intolerant und muffig. Die Hautevolee gab sich höfisch. Rebellische Geister wandten sich vom Salon ab und Anlaufpunkten der Mittelschicht zu: dem Verein, dem Kaffeehaus und der Presse.
Radikale Gedanken und Geheimpolizei
Der Vormärz ließ die Spaltpilze sprießen. Zwar förderte die Entfaltung des politischen Lebens den Salon-Esprit, sagt die Historikerin Petra Wilhelmy, aber “tiefe Risse” folgten: Das Ideal freier Aussprache traf auf die Gefahr, dass sich die Geselligkeit durch Frontenbildung auflöste. Nur in wenigen Zirkeln durften Radikalliberale und Demokraten miträsonieren und Themen wie Verfassung, Wahlrecht oder Arbeiterelend mitbringen. Sozialist Ferdinand Lassalle war als Salonroutinier ein Exot. Nur Ausnahme-Salonnièren wie Bettina von Arnim, Fanny Lewald oder Lina Duncker hatten die Nerven, unter dem Auge der Geheimpolizei zur Lesung verbotener Schriften zu laden oder Leute aufs Sofa zu bitten, die ein Bein im Gefängnis hatten.
Im ruhigeren Fahrwasser nach 1850 spielten Salons bei der Bildung moderner Parteien eine Rolle. Das war für die Frauen wichtig, denn Preußen verbot ihnen zwischen 1850 und 1908 die Mitgliedschaft in politischen Vereinen. In den Salons waren immer häufiger Berufspolitiker zu Gast. Lagerdenken machte sich breit. Legendär ist die jahrzehntelange Rivalität der Pro- und Anti-Bismarck-Salons: Bei Hildegard “Higa” von Spitzemberg netzwerkten seine Fans, seine Feinde schlürften bei Marie “Mimi” von Schleinitz und Fürstin Marie Radziwill ihren Punsch.
Die Grandes Dames inszenierten sich als Karriere- und Machtmakler. Zu Politikern, Spitzenbeamten, Generalen, Diplomaten und Industriellen stießen Lobbyisten und Presse. Es wurde durchgestochen und geleakt. In neofeudalen Residenzen und Luxushotels waberte der Qualm schwerer Zigarren und die “scharf bureaukratische Luft der Hauptstadt” (Fedor von Zobeltitz). Salons wurden quasi professionell gemanagt. Als stilvoll empfanden viele alte Szenegänger sie nicht mehr. Sie lamentierten “das Aussterben der Salons”.
Der Weltkrieg versenkte das alte Salongefühl, gebar aber neues. Die „rote Gräfin“ Hetta von Treuberg schuf einen Mitte-Links-Salon der Pazifisten, um einen Verständigungsfrieden auf die Agenda zu heben. Der Salonnière brachte das Verhöre, Hausdurchsuchungen und Internierung ein. Den Salon führte sie in der Weimarer Republik fort, was aber den nervösen neuen Machthabern genauso missfiel, zumal Salondiskurse immer öfter in öffentliche Debatten mündeten. In der Republik traten Salonnièren aus der Privatsphäre heraus. So auch Katharina von Oheimb, die den letzten großen Politsalon Berlins führte. Sie zog 1920 für die Deutsche Volkspartei (DVP) in den Reichstag ein. “Kathinka” hielt wenig von Fraktions- und Parteidisziplin. Lieber zog sie lagerübergreifend Strippen. Ihr Salon galt der Politik- und Wirtschaftsprominenz als “Clearinghouse der Nachrichten und Meinungen” (Kurt Reibnitz). 1924 gab sie ihr Mandat auf. Ihr Salon schillerte fort. Dieser Establishment-Ikone widmete Kurt Tucholsky in der “Weltbühne” garstige Reime (siehe Seite 70).
Habitué Hitler
Zu den Merkwürdigkeiten der zwanziger Jahre gehört, dass sich feinsinnige Kreise in ganz Deutschland der braunen Ideologie öffneten. Sie machten die Nazis im Wortsinn salonfähig. Zwei Tage nach seiner Haftentlassung 1924 begann Adolf Hitler durch die Salonschickeria zu tingeln. Er hatte drei Jahre öffentliches Redeverbot und brauchte Ersatzbühnen. Geschickt führten ihn Gönner als spannende Avantgarde-Persönlichkeit ein, die man kennen müsse. Hitler trug Smoking und wurde Habitué, wie andere Nazigrößen auch. Was für ihn zählte, war das Elitenpublikum mit Geld, Einfluss und Kontakten. Staunend und berauscht lauschte es seinen Endlosmonologen. “Hitler ließ sich nicht auf die ungeschriebenen Regeln des bürgerlichen Salons ein, er verletzte das essentielle Moment der Geselligkeit, das Gespräch”, stellt Wolfgang Martynkewicz fest. “Das oft beschworene Prinzip des Salons war offenbar längst preisgegeben.”
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Denken. Das Heft können Sie hier bestellen.