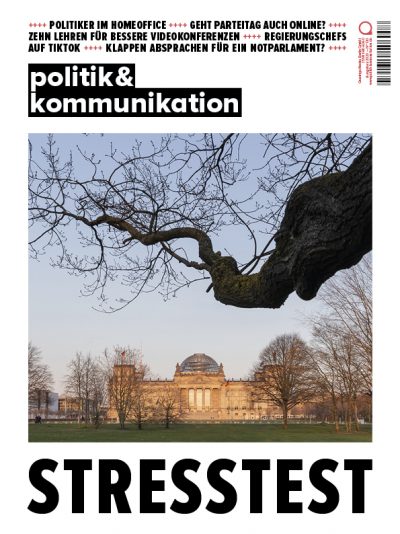Herr de Weck, warum haben Sie dieses Buch gerade jetzt geschrieben?
Liberale und Linke wirken eher defensiv heutzutage. Und manche Konservative kippen ins Reaktionäre. Da wollte ich sie aufrütteln. Im digitalen Zeitalter ist die Demokratie mehr denn je die zukunftsweisende Staatsform. Und sogar die ungute Erfahrung der Corona-Krise bestärkt mich in dieser Zuversicht. Autoritäre Sprücheklopfer à la Donald Trump oder Jair Bolsonaro haben mit ihrer wirren Krisenpolitik versagt. Die Anhängerschaft der Populisten dürfte teils wieder stärker zu sachlichen Politikerinnen und Politikern neigen, die an Lösungen arbeiten. Jetzt ist die Stunde der Demokraten. Mit dem Buch will ich den Konservativen, Liberalen und Linken Argumente und auch konkrete Vorschläge anbieten.
In Deutschland werden meist Schweizer Stimmen aus dem erzkonservativen Spektrum gehört. Ärgert Sie das manchmal?
Lassen Sie mich mit einem klaren Jein antworten, denn die Schweiz ist mehrdeutig. Lang war sie die Pionierin des Liberalen – dann aber des Reaktionären. Im europäischen Revolutionsjahr 1848 setzten sich in der Eidgenossenschaft die Liberalen durch, während sie in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich niederkartätscht wurden. Daraufhin floh eine fortschrittliche Elite von Wissenschaftlern, Künstlern und Unternehmern zu uns. Das hat Europas erste liberale Demokratie gestärkt. Viel später wurde die Schweiz leider zur “Avantgarde” des Populismus. Ausgerechnet 1968 verlangte das erste fremdenfeindliche Volksbegehren, 350.000 italienische Migranten auszuweisen. Nach erbitterter Debatte lehnten bloß 54 Prozent der Schweizer dieses Ansinnen ab. Ich sage bewusst “der Schweizer”, weil Schweizerinnen damals kein Stimmrecht hatten! In Sachen Gleichstellung war die direkte Demokratie unsäglich langsam, da viele Männer ihre Vormacht ungern preisgaben. Sonst aber setzen die Volksbegehren sehr früh neue Themen auf die politische Agenda, 20 bis 30 Jahre früher als in parlamentarischen Demokratien. Und das gilt eben auch für Fortschrittliches wie die Ökologie. Schon in den 1970er Jahren fanden Volksbegehren für mehr Umweltschutz eine Mehrheit.
Trotzdem werden in Deutschland vor allem reaktionäre Schweizer wie Roger Köppel oder die rechtsbürgerliche “NZZ” – von Hans‑Georg Maaßen als “Westfernsehen” bezeichnet – gehört.
Die Schweiz ist polarisierter als Deutschland. Die Sozialdemokratie ist linker, Bürgerliche sind rechter. Als die AfD noch nicht in den Bundestag eingezogen war, haben deutsche Talkshows eine Zeit lang gern den Demagogen Köppel „importiert“, er war der Reaktionär vom Dienst. – Viele Deutsche ihrerseits misstrauen der direkten Demokratie, weil sie sich selbst misstrauen. Sinnbild dafür ist Konrad Adenauers Büste in Bonn. Argwöhnischer kann man nicht auf die Passanten schauen, als dies Adenauers riesiges Bildnis tut: Viel zu viele Bürger hatten sich von Hitler verführen lassen. Darum wurde beim Aufbau der Bundesrepublik die direkte Demokratie bloß in homöopathischer Dosis auf kommunaler und Länderebene zugelassen. Doch nun ist ein Dreivierteljahrhundert verstrichen. Die Bundesrepublik hat sich als eine der besten Demokratien in Europa erwiesen. Und die Deutschen haben den Kraftakt der Wiedervereinigung – bei allen Irrungen und Wirrungen – besser gemeistert, als sie selber denken. Das spricht dafür, direktdemokratische Elemente zu stärken. Alle Parteien haben dazu ein Lippenbekenntnis abgelegt. Doch geben Berufspolitiker nur widerwillig etwas von ihrer Macht ab.
“Es reicht nicht, dass sie immer nur die Populisten kritisieren”
Die Konservativen sind seit längerem in einer Krise und drohen nach rechts abzukippen. Worin begründet sich ihre Krise?
Ich stamme aus einer traditionsbewussten Familie und beobachte, wie es vielen Konservativen schwerfällt, in disruptiven Zeiten konservativ zu sein: Was lässt sich bewahren? Im digitalen Zeitalter ist das Heute bereits ein Gestern. Die rasante Beschleunigung überfordert Konservative, die dann Halt bei den Reaktionären suchen. Autoritäre Populisten suggerieren, man könne durchregieren. Es bedürfe nur eines starken Mannes – denn ein Mann muss es offenbar sein –, um die Politik zu vereinfachen, die Komplexität der postmodernen Welt zu verringern. Schon Goethe beklagte die allzu schnellen Zeiten, die “nichts reifen lassen”.
Auf der anderen Seite sagen Sie, Linke und Liberale seien zu defensiv. Wie äußert sich das?
Es reicht nicht, dass sie immer nur die Populisten kritisieren. Der tiefere Grund für das Emporkommen dieser Rechten ist, dass die liberale Demokratie nicht mehr ganz so liberal ist. Vor der Corona-Krise galt längst nicht mehr der Primat der Politik, wie es die liberale Ordnung vorsieht, sondern der Primat der Wirtschaft: It’s the economy, stupid! Damit schwand die Gestaltungskraft der Demokratie. Das verbitterte jene Menschen, die sich an den Rand gedrängt fühlen und bald auch als Zaungäste der Politik vorkommen. Nicht unbedingt, weil es ihnen bereits wirtschaftlich schlecht geht, aber weil sie absehen, dass es ihnen und ihren Kindern schlechter gehen wird. Sie empfinden es, dass ihre analogen Kenntnisse eine kurze Halbwertszeit haben, dass ihre Region – und zwar nicht nur in den neuen Bundesländern, denken Sie an das Ruhrgebiet! – peripherer wird. Die Verunsicherten suchen Identität, Trost und Stütze bei reaktionären Politikern. Aber Populisten sind Betrüger an ihrer Klientel.
An wen denken Sie konkret?
Schauen Sie, wie Donald Trump redet und was er tut. Die kleinen Leute im Mittleren Westen hatten frohlockt: Endlich haben wir unseren Repräsentanten in Washington. Als allererstes senkte Trump die Steuern – doch das eine Prozent reichste Amerikaner erhielt gut 80 Prozent des Geldes, auf das der Staat verzichtete. Trump verprellt zynisch seine Wähler, auf die Gefahr hin, dass sie noch weiter nach rechts driften – es sei denn, die liberale Demokratie wird aktionsfähiger, um den besorgten Bürgern neue Perspektiven zu eröffnen. Eine liberale Demokratie für möglichst viele, statt einer neoliberalen Demokratie für allzu wenige.
“Ihre Politik wie ihre Kommunikation bestehen aus Show”
Aber gerade den festen Kern der Trump-Wähler scheint das gar nicht zu stören.
Trump veranstaltet für sie ein Festival der Ablenkungen, das in der Corona-Krise freilich weniger zieht. Meine französische Muttersprache – mit zehn Jahren lernte ich Deutsch, ich liebe diese Sprache – kennt das Wort “divertissement”. Es bedeutet zugleich Ablenkung und Unterhaltung. Darin sind Populisten Meister. Ihre Politik wie ihre Kommunikation bestehen aus Show.
Wie sieht diese Show aus?
Kernelemente der Show sind zum Ersten die durchgehende Personalisierung, weit weg von abstrakten Begrifflichkeiten und strukturellen Analysen: Alles wird auf Personen reduziert. Zum Zweiten lebt jede Show von einer gnadenlosen Reduktion der Komplexität; eine nuancierte Show wäre ein Widerspruch in sich. Zum Dritten braucht eine Show immer Gut und Böse. Zum Vierten muss sie den Anschein erwecken, alles gehe blitzschnell: Eine Show ohne Tempo ist keine. Dem haben sich die Populisten verschrieben, immer läuft was. Vordergründig sind sie “interessanter”, jedenfalls ablenkungsreicher als sachliche Politiker.
Was kann man diesem Politikstil entgegensetzen?
Je ernster die Lage – und wir durchleben einen härteren Abschnitt – , desto weniger wirkt die Verführungspolitik reaktionärer Populisten. Viele ihrer Mitläufer begreifen allmählich, dass wir handfeste Lösungen brauchen werden, und zwar sowohl in der sozialen Krise nach dem Corona-Stillstand als auch in der Klimakrise. Aber sozialere und ökologischere Lösungen kann nur eine Demokratie durchsetzen, die den Primat der Politik behauptet. Und namentlich gegenüber dem übermächtigen Verbund aus Big Data und Big Money tut sie das nicht. Über die vergangenen Jahrzehnte hat ein Teil der Wirtschaft viel entschiedener als die Demokratie die politischen Rahmenbedingungen gesetzt. Überdies sollten wir mit Weitblick an einer Ökodemokratie arbeiten: Die Natur muss zur Teilnehmerin an der Demokratie werden. Wer den Bürgern Perspektiven eröffnet, Zutrauen in die Zukunft weckt, bremst den Zulauf zu den Populisten. Das ist mein Grundgedanke.
“Die Debatte über Modernisierungen der liberalen Demokratie hat noch nicht einmal angefangen”
Also verschwenden die Parteien zu viel Energie darauf, Fehler in der Argumentation des politischen Gegners zu entlarven, statt Lösungsvorschläge für Probleme der Zukunft zu unterbreiten?
Kritik an den Populisten ist nötig und wird intensiv betrieben. Zukunftsperspektiven zu schaffen, ist nötiger und wird sträflich vernachlässigt. Spätestens 2008 in der großen Finanz- und Vertrauenskrise erwies sich, dass die liberale Demokratie überfordert war. Sie hatte den Geldhäusern keine straffen Rahmenbedingungen zu setzen gewusst, die Finanzwirtschaft drehte durch. Bald musste die Allgemeinheit für einen Teil der Kosten aufkommen. Wird ein Teil der Verluste sozialisiert, beschädigt das die Glaubwürdigkeit der liberalen Demokratie massiv. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern kam ein Ohnmachtsgefühl hoch – darum hat sich seither im ganzen Westen die Parteienlandschaft rasant verändert. Doch auf die Vertrauenskrise antwortete man mit halbherzigen Reformen des Finanzsystems, nicht mit Reformen der Demokratie, um sie zu stärken. Die Debatte über Modernisierungen der liberalen Demokratie hat noch nicht einmal angefangen. Mein Buch dient dem Zweck, im besten Fall eine solche Diskussion zu lancieren.

Der Schweizer Roger de Weck ist seit 44 Jahren im Journalismus tätig. Nach Stationen bei der “Tribune de Genève”, der “Weltwoche” und dem “Tages-Anzeiger” war er von 1997 bis 2001 Chefredakteur der “Zeit”. Zuletzt leitete der 66-Jährige von 2011 bis 2017 als Generaldirektor die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft. (c) Lisa-Marie Reingruber
Das Buch trägt den Titel “Die Kraft der Demokratie”. Worin liegt diese Kraft?
Jetzt folgt in unserem Gespräch eine weitere “Liebeserklärung”: Weshalb liebe ich die Demokratie? Weil sie die Staatsform des Imperfekten ist. Sie sucht nicht wie totalitäre Systeme nach der Perfektion, dem unanfechtbaren Anführer oder jener Partei, die immer recht hat. Sehr präzis heißt sie liberale Demokratie, weil sie auf Konkurrenz baut. Sie setzt die drei demokratischen Institutionen Parlament, Regierung und Justiz in Wettbewerb – denn wer alle Macht hätte, würde die missbrauchen. Und sie setzt die drei demokratischen Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Nachhaltigkeit in Wettbewerb – laufend werden sie neu austariert.
Nachhaltigkeit?
Die dritte Losung aus der Französischen Revolution ist Brüderlichkeit, Solidarität. Die Brüderlichkeit interpretiere ich zeitgemäß auch als Nachhaltigkeit: Im gemeinsamen Haus Erde müssen wir brüderlich und schwesterlich miteinander umgehen, damit das Haus bestehen bleibt. Das ist nachhaltig. Zu jeder Zeit in jeder Demokratie läuft das Kräftemessen zwischen Parlament, Regierung und Justiz. Und zu jeder Zeit – das ist das Wesen liberaler Debatten – herrscht Streit zwischen denen, die zu Lasten der Gleichheit mehr Freiheit fordern, und denen, die Gleichheit als Voraussetzung der Freiheit benachteiligter Mitmenschen sehen. Politik ist nichts anderes als die Dauerdebatte über das Verhältnis zwischen Freiheit, Gleichheit und Nachhaltigkeit, Letztere von steigender Bedeutung. Das ist genial, nämlich eine Staatsform, die nicht sagt: “So ist es.” Sondern die auf das Wechselspiel rivalisierender Institutionen und Werte setzt.
“Keine andere Staatsform ist so lernfähig wie die Demokratie”
Ist das eher ein funktionales Argument oder eine Legitimation?
Beides. Die liberale Demokratie baut auf die Mündigkeit und Lernfähigkeit der Bürger, doch sie hat die Unzulänglichkeiten unserer menschlichen Natur einkalkuliert. Im Menschen regt sich der Wille zur Freiheit, aber auch das Bedürfnis nach Gleichheit – jedenfalls nach nicht zu viel Ungleichheit. Und das Erfordernis der Nachhaltigkeit ist evident geworden.
Die Demokratie ist also wie für uns geschaffen?
Sie ist human, das heißt unvollkommen und entwicklungsfähig. Keine andere Staatsform ist so lernfähig wie die Demokratie, wiewohl viel zu langsam.
Die Langsamkeit der Demokratie ist ein häufiger Vorwurf. Bei so epochalen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Digitalisierung und aktuell der Corona-Krise schauen einige neidisch nach China, wo alles schnell geht.
Weil die Volksrepublik China eine Diktatur ist, ließ sie die Umweltschäden dermaßen weit gedeihen, dass es in Peking kaum mehr Luft zum Atmen gab. Am Schluss bangte die Parteiführung um die eigene Gesundheit und sah ein: So geht‘s nicht weiter. Und weil China ebendiese Diktatur ist, konnte sie den Kurs radikal wechseln, in Peking den Verkehr mit fossilen Brennstoffen verbieten. Aber die Umweltlage im Lande bleibt verheerend. Der Leistungsausweis der Demokratien ist gewiss völlig ungenügend, trotzdem viel besser. Wer eine Ökodiktatur herbeisehnt, wird wenig Öko und viel Diktatur bekommen. Autoritäre denken einzig daran, ihre Macht zu verewigen – siehe den ewigen Präsidenten Putin.
Trotzdem scheint die Demokratie gegenüber großen Aufgaben handlungsunfähig.
Kein politisches System kann schneller sein als der Mensch. Bis Menschen umdenken, verstreicht Zeit. Die Langsamkeit der Demokratie spiegelt die Langsamkeit unseres Denkens und Umdenkens. Doch wo jetzt umzudenken ist, gibt es keine Alternative zum erkenntnisorientierten Diskurs in liberalen Demokratien: Nur Diskussion bringt solches Umdenken. Rasche Top-down-Maßnahmen, die fast niemand verinnerlicht, verpuffen. In modernen Unternehmen weiß das jeder – in der Politik noch nicht.
In Ihrem Buch machen Sie auch konkrete Vorschläge zur Modernisierung der Demokratie. Das Grundparadigma der Vorschläge ist eine starke Rolle der Natur in unserem politischen System.
Der Primat der Politik muss behauptet werden, auch damit die Natur zur Teilnehmerin an der Demokratie wird. Letzteres ist unmöglich ohne Ersteres. Der Raubbau an der Natur läuft auf einen Raubbau an der Gesellschaft, auch an unserer Gesundheit, schließlich auf einen Raubbau an der Demokratie hinaus. Verschlechtern sich die Umweltbedingungen, verhärtet sich die Gesellschaft und die Demokratie büßt weitere Glaubwürdigkeit ein. Die Generation Greta, die vor der Corona-Zeit auf die Straße ging, baut auf die liberale Demokratie, um ein ökologisches Gleichgewicht herzustellen. Das verpflichtet uns, diese Demokratie aktionsfähiger zu machen. Es wäre verheerend, wenn die jungen Jahrgänge von der Demokratie enttäuscht würden. Manche Jugendlichen sind verantwortungsbewusster als ihre Eltern. Und alle beteuern: Ihr Jugendlichen habt ja recht. Worauf man luftige Klimapakete schnürt, die diese Generation ernüchtern.
Zählt der Green New Deal von Ursula von der Leyen für Sie auch zu den Luftnummern?
Vorderhand ist er Luftnummer pur. Aber auch die Corona-Krise mag hier das Bewusstsein weiter schärfen. In der Pandemie wie in der Klimapolitik gilt: Im nationalen Alleingang klappt‘s nicht. Die EU wird das, etwas zu spät, lernen – sie ist im Grunde schon dabei. Da bin ich ein optimistischer Fatalist. Oder meinetwegen ein fatalistischer Optimist.
“In der Politik überzeugt derjenige, der zu seinen Grundwerten steht”
Sie schlagen auch zusätzliche Institutionen vor, wie zum Beispiel eine zweite Umweltkammer im Parlament, einen Umweltrat in der Regierung und einen Bundestransparenzhof. Reichen die bestehenden Institutionen in Deutschland nicht?
Die insgesamt zwölf Vorschläge münze ich nicht alle auf die Bundesrepublik. Viele Nationen und die EU müssen ihre Institutionen erneuern. Die Umweltkammer wäre am einfachsten in den fortschrittsfreudigen nordischen Demokratien einzurichten, die nur eine Parlamentskammer haben. In anderen Demokratien sind Bundesländer bzw. Bundesstaaten in einer Kammer der Regionen vertreten – zum Beispiel dem Bundesrat oder dem US-Senat. Doch jetzt, wo die natürlichen Ressourcen ins Zentrum unseres Lebens rücken, wäre eine “Kammer der Natur” mit gewählten Umweltabgeordneten aller Parteien von Vorteil. Diese Abgeordneten würden jeden Gesetzentwurf einzig unter dem Gesichtspunkt der Ökologie debattieren. Die Umweltkammer wäre ein Fanal. Für die Jugendlichen von Fridays for Future wäre sie ein Weg in die Institutionen.
Möchten Sie so den Protest von der Straße holen?
Straßenprotest gibt es jederzeit. Als Jugendlicher war ich nicht selten auf dem Pflaster. Solche Bewegungen können ein Hinweis an die Demokraten sein, ein neues Thema auf die politische Agenda zu setzen. Demonstrationen als Frühwarnsystem. Je proaktiver eine Demokratie, desto weniger Straßenprotest erlebt sie.
Ein Blick nach vorn: Welche Themen sollten im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021 im Vordergrund stehen und wie kommuniziert werden?
Schwer zu sagen, was nach Corona am meisten gefragt sein wird. Ich vermute: erstens gelebte Gerechtigkeit, denn die zahllosen Verlierer des Corona-Wirtschaftseinbruchs hegen jetzt schon hohe Erwartungen an die Allgemeinheit; zweitens Respekt für Senioren, die als Risikogruppe am längsten “soziale Distanz” einhalten müssen, sich mit der Zeit ausgegrenzt vorkommen könnten; drittens der Wille zur Nachhaltigkeit, denn Klimakrise und Pandemie werfen die Frage auf, wohin die Gesellschaft sich fortentwickeln sollte – gewiss nicht wieder in Richtung Hyperkonsum und Raubbau. Versagen hier die Demokraten, spielen sie den Populisten in die Hände. Welche Kraft hatte vor der Corona-Krise Erfolg in der Bundesrepublik? Die Grünen. Und warum? Weil sie sich treu bleiben. Sie schielen nicht, wie ich es von Natur aus tue: Sie schauen nicht dauernd, ob man sich eventuell doch ein bisschen auf die Reaktionäre hinbewegen sollte. Sie vertreten ihre Werte und haben ein vernünftiges Projekt: Anders als die einstigen 68er wollen sie nicht die Welt verbessern, sondern das Schlechte abwenden. Das ist realistisch.
Und die anderen Parteien?
In der Politik überzeugt derjenige, der zu seinen Grundwerten steht. Wer vor allem Marketing betreibt, kann kurzfristig Erfolg haben. Auf die Dauer trägt das allerdings kaum. Die FDP hat das zu lang so gehandhabt: Wer weiß noch, was die Partei verkörpert? Am schwersten hat es die SPD. Sie hatte sich freidemokratisiert. Nun will sie sich “resozialdemokratisieren”, ohne genau zu wissen, was das sein wird. Zu schaffen macht ihr der Wechsel von den früheren Verteilungskämpfen zu heutigen Kulturkämpfen. In Verteilungskämpfen schimpfen die Gewerkschaften über die Arbeitgeber und vice versa. Dann findet man sich in der Mitte. Bei Kulturkämpfen ist der Kompromiss schwieriger, denn es stehen sich zwei grundverschiedene Beziehungen zur Nation und Migration, zur Liberalität oder zur Umwelt gegenüber. Die Grünen verkörpern eine kulturelle Neuerung, nämlich die Ökologie. Deshalb hatten sie jahrelang mehr Erfolg als die auf Verteilungskämpfe getrimmten Volksparteien. Nach der Corona-Wirtschaftskrise dürfte angesichts der sozialen Nöte und des Streits um die Finanzierung der Riesenkosten des Stillstands der Stellenwert der Verteilungskämpfe erneut zunehmen.
Ist außer den Grünen und ihren Gegnern von der AfD niemand mit sich im Reinen?
Bei der CSU weiß man, woran man ist: eine leicht linke Sozialpolitik, eine manchmal nur rhetorisch konservative Gesellschaftspolitik und eine nur halbwegs dirigistische Industriepolitik, viel erfolgreicher als in Frankreich. Diese schillernde Partei verkörpert das gute Regieren, auch dank der erstklassigen bayerischen Beamtenschaft. Das wird jetzt erst recht gefragt sein.
Wir fassen zusammen: Authentische Parteien werden erfolgreich sein. Die übrigen Parteien müssen ein authentisches Bild ihrer selbst finden. Außerdem stellen wir fest, dass zu Ihren Lieben die Demokratie und die deutsche Sprache zählen.
Seit 44 Jahren liebe ich zudem meinen Beruf. Die gesammelten Erfahrungen darf ich auf zwei Grundregeln der Kommunikation – auch in der Politik – verkürzen. Erstens: Aus Überzeugung zu dem stehen, was man ist, sonst kommt die Botschaft nicht rüber. Zweitens eine Binsenweisheit, die sich durchweg bestätigt: Hochmut kommt vor dem Fall. Wer hochmütig geworden ist, kommuniziert nicht mehr, weil er sich nicht auf Augenhöhe mit seinen Adressaten bewegt. Seine Botschaft kann argumentativ so gut oder so durchdacht oder so clever sein, wie sie will – sie kommt nicht an. Auch das ist ein Vorzug der Demokratie. Ich glaube, auf die Dauer belohnt sie die Authentizität und bestraft den Hochmut.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 130 – Thema: Stresstest. Das Heft können Sie hier bestellen.