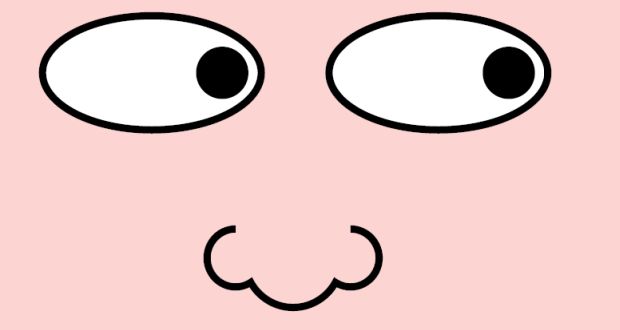Eigentlich sollte die Gegnerbeobachtung ausgestorben sein. Die Aufgabe werde bis 2017 von Medien und Smartphone-Reportern übernommen, vieles ließe sich automatisieren. So hatte es Frank Wilhelmy, Gegnerbeobachter der SPD, 2013 auf einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung gesagt. Ironisch, wie er betont. Vier Jahre später sitzt er immer noch im Willy-Brandt-Haus und recherchiert zur politischen Konkurrenz. “Es gibt heute mehr zu tun denn je: mehr Parteien, mehr Hass und mehr Fake News. Unsere Aufgabe ist es, ungerührt die politischen Unterschiede zur Konkurrenz zu markieren, zugespitzt, aber fair”, sagt er.
Allen Prognosen, die Gegnerbeobachtung könne automatisiert werden zum Trotz, ist sie nach wie vor Handarbeit und unverzichtbar für Parteien. “Gegnerbeobachtung ist die Pflicht der Partei, im Wahlkampf über ihre Mitbewerber informiert zu sein”, sagt Andreas Jungherr, Politikwissenschaftler an der Universität Konstanz. Der Bedarf sei gestiegen und die Analyse nicht von Maschinen zu leisten. Und auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat kürzlich gesagt: “Ich erwarte von jedem, der Wahlkampf macht, dass er die politische Konkurrenz genau im Blick hat, ob in den Wahlkreisen oder auf Bundesebene.”

Foto: privat
“Wir halten uns für einen ehrenwerten Beruf.”
Frank Wilhelmy (SPD)
In erster Linie geht es bei der politischen Gegnerbeobachtung darum, mitzubekommen, was andere machen – welche Themen sie setzen, welche Argumente sie nutzen, welche Personen sie positionieren und wie Medien und Netz darauf reagieren. Der Alltag hat nichts mit dem halbseidenen Image zu tun, das Gegnerbeobachtung dank früherer Skandale hat. “Wir halten uns für einen ehrenwerten Beruf”, sagt Wilhelmy. Der idealtypische Gegnerbeobachter liest jeden Tag Zeitungen, surft im Web, besucht Wahlveranstaltungen, telefoniert mit Journalisten und schreibt am Ende Vermerke, die im Zweifel niemand liest. “Die Informationen, die wir bei der Beobachtung der politischen Konkurrenz nutzen, sind alle öffentlich zugänglich. Es kommt nur darauf an, wie gut man recherchiert”, sagt Christina Kaindl, Leiterin Strategie und verantwortlich für die Gegnerbeobachtung bei der Linken.
Die Ressourcen für die Recherche sind begrenzt, bei allen Parteien. 2012 hatten die Grünen eine Referentenstelle für Gegnerbeobachtung finanziert, so steht es im Protokoll der Bundesdelegiertenkonferenz. Heute ist sie eine Aufgabe von vielen im Team des Bundesgeschäftsführers. CDU, FDP, Linke: Sie alle verneinen, eigene Mitarbeiter im Stab zu haben, die ausschließlich Informationen über den Gegner recherchieren. Das ändert aber nichts daran, dass es alle machen, auch wenn kaum einer darüber spricht. Früher war die Gegnerbeobachtung explizit Thema: Die Grünen präsentierten 2010 ein eigenes Tool auf der Webseite, 2013 einen E-Mail-Account für die Gegnerbeobachtung in Hessen. Die SPD leistete sich im Bundestagswahlkampf 2002 einen eigenen Blog, nicht-regierungsfaehig.de, um Fehltritte von Stoiber und Westerwelle zu dokumentieren. Heute diskutiert sie die Agenda 2010 – und die CDU den Haustürwahlkampf. Die Parteien sind mit sich selbst beschäftigt. “Das Narrativ von Wahlkampagnen verändert sich. In Zeiten der Großen Koalition gibt es keinen politischen Gegner mehr. SPD und CDU wollen nicht den Gegner besiegen, sondern ihre eigenen Stärken betonen und Wähler für sich mobilisieren”, sagt Jungherr.

Foto: Dirk Koch
“Der Wahlkampf in Deutschland hat moralische Grenzen.”
Andreas Jungherr (Universität Konstanz)
Auf die Agenda rückte die Gegnerbeobachtung 1998, nach 16 Jahren Helmut Kohl durch die Oppositionspartei SPD. Mit Gründung der “Kampa” professionalisierte sich der Wahlkampf, Begriffe und Konzepte aus dem angelsächsischen Raum schwappten nach Deutschland, darunter die Gegnerbeobachtung. “Kommunikatoren nutzen gerne eine Kriegsrhetorik, um sich und andere zu motivieren”, sagt Jungherr. “Wahlkämpfe sind Extremsituationen: wenig Schlaf, viel Arbeit, man bewegt sich in einem Umfeld, das man nur schwer kontrollieren kann, in dem aber jede Handlung große Konsequenzen haben kann.” SPD-Werber Frank Stauss hat das in seinem Buch “Höllenritt Wahlkampf” belegt.
Heute sprechen die Parteien lieber von “Konkurrenzbeobachtung” oder einer Analyse des “politischen Mitbewerbers”. Alle Begriffe sind mehr als eine deutsche Übersetzung der englischen “Opposition Research” – oder besser gesagt: weniger. In den USA recherchieren ganze Thinktanks zu brisanten Details der Kandidaten, gerne auch Halbseidenes und das halb legal. Im Trump-Wahlkampf sollen russische Organisationen die E-Mails des Clinton-Teams gehackt haben, 44.053 E-Mails hat Wikileaks von Juli 2016 an publiziert, mehrere Mitarbeiter mussten gehen. Das gesamte Ökosystem einer Partei stehe unter Beobachtung, das habe er unterschätzt, sagte kürzlich Clintons Wahlkampfmanager Robby Mook.
In Deutschland stehen Parteien und Agenturen hinter dem, was im Wahlkampf passiert, sie können sich nicht auf Political Action Committees (PAC) berufen, deren Aktionen sie nicht kontrollieren. “Wenn die Parteien weniger starke Strukturen haben und weniger in der Verantwortung stehen, gibt es auch eine geringere Beißhemmung”, sagt Jungherr. “Auch wenn wir uns gerne beschweren, dass der Wahlkampf hierzulande langweilig ist, ist es positiv, dass er moralische Grenzen hat.”

Foto: Caitlin Hardee
“Wahlkampf braucht Zuspitzung.”
Nils Droste (FDP)
Die Gegnerbeobachtung ist nur so aggressiv, wie die Gesamtstrategie es zulässt, sie liefert höchstens die Basis für Negative Campaigning. Doch in Zeiten von Fake-News und Hate-Speech sind die Parteien vorsichtig. Das beobachtet auch Miriam Hollstein, Politikredakteurin der “Bild am Sonntag”: “Durch die sozialen Netzwerke ist viel Hass und Pöbelei in die Welt gekommen. Die Erregungszyklen sind sehr schnell und heftig, es werden regelrechte Treibjagden auf Politiker betrieben, da hält die Politik sich zurück.”
Von einem Fairness-Abkommen ist die Rede, nach der Trump-Wahl unter anderen von FDP-Generalsekretärin Nicola Beer ins Spiel gebracht. Ziel sei es, auf Fake-News und Bots zu verzichten, aber auch auf “persönliche Verunglimpfungen”, sagt Beer. Immer wieder kommt das Abkommen auf, auch in den Landtagswahlkämpfen – und immer wieder gibt es Beschwerden, dass Politiker Grenzen überschreiten. Als Christian Lindner vom “Merkel-Malus” sprach, kritisierte Peter Tauber ihn, zog im Interview mit Hollstein eine Parallele zum Stil der AfD. “Früher wäre das ein normaler Umgangston gewesen. Bei Politikern wie Franz Josef Strauß gehörte die Beleidigung dazu”, sagt Hollstein, die das Fairness-Abkommen für eine “Idiotie” hält.
“Wahlkampf braucht Zuspitzung”, sagt Nils Droste, Pressesprecher der FDP. “Wir sind frech und mutig, aber mit Stil. Wir wollen Lust machen auf die politische Debatte und sind dabei angriffslustig.” Auch Christina Kaindl sagt: “Man kann im Wahlkampf auch mal auf den Tisch hauen. Ein bisschen Schärfe muss erlaubt sein. Problematisch ist es, wenn es ins Persönliche geht.” Skandale müssten immer einem Thema dienen. Gerüchte über eine angebliche Homosexualität oder Geliebte seien tabu, wenn sie nichts mit der Sache zu tun haben, sagt auch Hollstein.

Foto: Niels Starnick/Bild am Sonntag)
“Wir dürfen nicht das Vorurteil bedienen, dass Politiker eine Saubande sind.”
Miriam Hollstein (BamS)
Medien sind noch immer Gatekeeper, wenn es darum geht, welches Potenzial Gerüchte und Informationen entfalten. “Die kampagnenstörende Kraft hängt vom Willen der Journalisten ab”, sagt Politikwissenschaftler Andreas Jungherr. Zu reaktiv hätten US-Medien im Trump-Wahlkampf Gerüchte aufgegriffen, die im Netz kursierten. Für Hollstein ist das okay, wenn man sie prüft und nicht bewusst noch mehr Politikverdrossenheit hervorruft: “Wir müssen anständig und sorgfältig unsere Arbeit machen und nicht durch unreflektierte Schlammschlachten das Vorurteil bedienen, dass Politiker eine Saubande sind.”
Die Debatten im Netz spielen eine immer größere Rolle, auch für die Gegnerbeobachtung. Rapid Response ist das Stichwort, schnelle Reaktion, weil ein Gerücht die Runde macht oder eine Diskussion stattfindet, an der man teilhaben will. Um “grüne Inhalte im Netz zu pushen und die Trolle und Populisten zu kontern”, haben die Grünen jetzt eine “Netzfeuerwehr” eingerichtet. Auch Nils Droste betont die Bedeutung von Rapid Response im Netz: “In den sozialen Netzwerken braucht man eine hohe Agilität. Wir beobachten die politischen Mitbewerber und reagieren schnell, wenn es angebracht ist”, sagt er.
Um die Trends schnell zu erkennen, setzen die Grünen vor allem auf Freiwillige und die FDP auf Mitarbeiter, die ohnehin mit eigenen Profilen im Netz unterwegs sind. Wer Digital Natives in seinen Reihen weiß, ist im Vorteil. Junge Aktive beschweren sich, dass Landesverbände mit einer Altersstruktur von 50 plus den Wahlkampf im Netz verschlafen. “Mir geht es nicht schnell genug”, sagt Lars Schmidt-von Koss (SPD) aus Schleswig-Holstein. “Ja, in sozialen Netzwerken tummeln sich viele Bekloppte, aber es ist ein Medium, über das sich Menschen eine Meinung bilden. Und entsprechend ernst muss man es nehmen.”
Für die CDU ist unter anderem die Junge Union (JU) im Netz aktiv. Sie beobachtet nicht nur, sie handelt auch, bastelt Memes, postet Videos und verbreitet diese über ihre Accounts oder Mitglieder. “Wenn man mich fragt, würde ich nicht verneinen, dass die Partei im Netz auch von privaten Accounts unterstützt wird”, sagt Conrad Clemens, JU-Bundesgeschäftsführer. Was viele teilen, kann die Debatten eben besser beeinflussen.

Foto: Jördis Zähring
“In der Debatte im Netz sind wir die Abteilung Attacke.”
Conrad Clemens (JU)
Wie das Video von Martin Schulz, in dem er auf einer Wahlveranstaltung in Würzburg die eigenen Unterstützer bittet: “Fangt doch mal an zu rufen, jetzt ruft doch mal Martin!” Die Sequenz stammt aus einem Beitrag des Magazins Kontrovers im Bayerischen Rundfunk, fünf Minuten, in Summe positiv, über Schulz und die mit ihm verbundenen Hoffnungen der SPD. Mitglieder der Jungen Union stellen die letzten 20 Sekunden als Clip ins Netz und entfachen eine Debatte darüber, wie echt der “Schulz-Hype” sei.
Den Spin, den das Video bekam, hatte Redaktionsleiter Andreas Bachmann so nicht vorhergesehen. Für ihn war es ein “amüsantes Ende eines Porträts”, mehr nicht. Doch als Kontrovers aufgrund des Medieninteresses die Szene selbst als Einzelvideo ins Netz stellt, wirft die SPD ihm Wahlkampf vor, auch als Bachmann nach Vorwürfen, man habe die Szene sinnentstellend zusammengeschnitten, das ungeschnittene Rohmaterial publiziert, zwei Minuten Applaus für Schulz. Die Vorwürfe sind für Bachmann absurd: “Wir haben keinen Wahlkampf gemacht, sondern über etwas berichtet, was mir überhaupt nicht dramatisch erschien. Man hätte darauf als SPD auch souveräner reagieren können.”
Der Schulz-Hype hatte die Union nervös gemacht. Wo Merkel hoffte, dass der Hype sich von selbst erledigt, drängten andere darauf, Schulz stärker in die Mangel zu nehmen. Aus Brüssel kam ein Dossier, acht Seiten mit Fehltritten des Spitzenkandidaten. Ralf Stegner warf der CDU Barschel-Methoden vor, von Fairness sei da keine Spur. Die CSU sprach von “Schizo-Schulz”, die Junge Union pushte den Satire-Account “Spesen-Schulz” und publizierte eine kugelrunde Schulz-Zeichnung mit der Überschrift “Martin Schulz findet Deutschland doof”. Für manche ist gerade der Auftritt der Jungen Union im Netz unter der Gürtellinie. Clemens sieht darin eine Handschrift: “Es gehört zur Jungen Union, dass wir schärfer auftreten können.” Und: “In der Debatte im Netz sind wir die Abteilung Attacke.”
Viele Ehrenamtler wollen kämpfen, Attacke hilft, sie zu mobilisieren. Ohne die Jugendorganisationen wäre eine Gegnerbeobachtung im Land nicht möglich. Eine enge Abstimmung wie zwischen JU und CDU, davon kann Christina Kaindl nur träumen: “Die Linksjugend lässt sich nicht so leicht einspannen wie die Junge Union. Sie macht einen eigenen Wahlkampf und betont ihre Unabhängigkeit.”

Foto: Martin Heinlein
“Die Gegneranalyse der anderen Parteien arbeitet oft mit vorhersehbaren Typisierungen.”
Christina Kaindl (Die Linke)
Statt eigene Trends zu setzen, müsse sie als kleine Partei versuchen, an bestehende Debatten anzuknüpfen, den “Konkurrenten” SPD vor sich hertreiben und Konzepte diskutieren, die oft den gleichen Ansätzen dienen. Wie den Ansatz “Soziale Gerechtigkeit”, mit dem die SPD in den Ländern scheiterte, an dem die Linke aber festhält – weil die Inhalte fehlten. Gegnerbeobachtung bedeutet, auch von anderen zu lernen, eine Art Benchmarking, wenn es um Inhalte und Strategien geht. Im Bundestagswahlkampf 2013 habe man genau beobachten können, wie die SPD die Linke verfolgt und wenig später ihre Konzepte bedient habe, sagt Kaindl: “Es war die erkennbare Strategie der SPD, unsere Ansätze abzudecken, um sie nicht einer Partei links der SPD zu überlassen.”
Öffentlich ist die Linke wie die AfD für viele Politiker eine Partei non grata, mit der man sich nicht detailliert auseinandersetzt. “Wenn sich Parteien am Parteiprogramm der AfD abarbeiten würden, würden sie daraus neuen Honig saugen”, sagt Politikwissenschaftler Andreas Jungherr. Das bedeutet nicht, dass es keine Dossiers über die AfD in den Parteien gibt, um sich zum Beispiel auf Angriffe und Debatten vorzubereiten – oder Dossiers über die Linke. Die Grünen sorgten 2009 für einen Skandal, als sie ihre Fraktionen in den Landesparlamenten baten, einen Fragebogen über die Abgeordneten der Linken auszufüllen. Die Aktion scheiterte, auch am Protest der eigenen Partei. “Damit sollte uns in einer Schlammschlacht mit einer möglichen DDR-Vergangenheit geschadet werden, statt sich inhaltlich mit uns auseinanderzusetzen”, sagt Kaindl. Die Gegneranalyse der anderen Parteien arbeite oft mit vorhersehbaren Typisierungen.
Manche Dossiers behält eine Partei lieber für sich, nicht alles, was die Gegnerbeobachtung analysiert, ist für die Öffentlichkeit gedacht. In Zeiten von Hacks müssen Informationen besser geschützt werden – hört man sich um in Deutschland, ist das noch lange nicht der Fall. “Die Vermerke zu unserer Gegnerbeobachtung waren immer sachlich. Man muss nur Angst vor einem Hack haben, wenn man etwas Schmutziges macht”, sagt Dirk Hundertmark, zuletzt Sprecher der CDU in Kiel, inzwischen Sprecher des schleswig-holsteinischen Innenministeriums. Die Junge Union wurde kürzlich gehackt und ist vorsichtiger: “Am besten ist es, man macht seine Notizen klassisch auf Papier”, so Clemens. Die Gegnerbeobachtung bleibt noch lange eine Handarbeit, die jeder macht – über die man zurzeit aber nicht gerne spricht.
Hinter den Kulissen: Schleswig-Holstein – aus Sicht eines Gewinners
Die Ressourcen für die Gegnerbeobachtung im Land sind begrenzt, gerade in einem kleinen Bundesland wie Schleswig-Holstein. “Man beobachtet den Gegner dadurch, dass man tagtäglich das politische Geschehen auswertet”, sagt Dirk Hundertmark, zuletzt Sprecher der CDU, Partei und Fraktion, in Kiel. Als Opposition hatte sie fünf Jahre lang Zeit dafür. Im Wahlkampf wollte sie zeigen, in welchen Punkten die Regierung nicht funktioniert. “Albig hat einfach auf Verlängerung gesetzt. Wir wussten, wir müssen Punkte finden, an denen die reine Inszenierung des Hochglanzes deutlich wird.”
Der Herausforderer hat sich am Amtsinhaber abgearbeitet – der Amtsinhaber auf Souveränität gesetzt. Ministerpräsident Torsten Albig habe ein Zusammentreffen mit CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther gemieden und die Auseinandersetzung Stegner überlassen, sagt Hundertmark: “Seine Strategie war es, dass sich die beiden streiten wie die Kesselflicker und er als Moderator über ihnen thront.” Als die CDU eine bildungspolitische Debatte über das verkürzte Abi lostrat, blieb die SPD beim Status quo, sprach vom “Schulfrieden” – und verlor. Die Basis war verärgert: “Die SPD hat die CDU in Schleswig-Holstein nicht ernst genug genommen. Der Wahlkampf war viel zu wenig inhaltlich, viel zu stark fokussiert auf eine Person”, sagt Lars Schmidt-von Koss, SPD-Aktivist in Schleswig-Holstein. “Man muss sich am Gegner abarbeiten. Das passiert aber nicht. Und das ärgert mich.” Es sind vor allem Freiwillige, die Wahlveranstaltungen besuchen, Strategien und Inhalte der Gegner dokumentieren. “Ohne die Basis hätte es nicht funktioniert”, sagt Hundertmark und lobt insbesondere die Junge Union. “Bei uns hat der Spirit gestimmt. Das hat meines Erachtens auf der anderen Seite gefehlt. Und als die SPD gemerkt hat, dass ihre Rechnung nicht aufgeht, war es für sie zu spät, das Ruder herumzureißen.” Wenig zuträglich war der Versuch aus der Basis der SPD, Günther mit einem Gerücht zu diffamieren: Er habe sie “Verdi-Schlampe” genannt, behauptete eine SPD-Funktionärin. Das Gerücht verfing nicht, ein Ausreißer in einem ansonsten sauberen Wahlkampf – und ein Angriff auf den politischen Gegner, der der eigenen Partei schadete.
Hinter den Kulissen: Nordrhein-Westfalen – aus Sicht der Verlierer
In NRW ist der Frust groß: CDU und FDP haben gepunktet, SPD und Grüne verloren. Das liege auch an der Gegnerbeobachtung, sagt ein Mitarbeiter aus dem SPD-Wahlkampfteam: “Wir haben als Gesamtpartei die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner vernachlässigt und zu stark auf Wohlfühl-Botschaften gesetzt.” Wie in Kiel fokussiert sich die SPD in Düsseldorf auf eine Person: Hannelore Kraft. Auch sie wollte dem Herausforderer Armin Laschet nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als nötig, zumal er sich schwer greifen ließ. Lange sah alles nach einer Großen Koalition aus in NRW, Laschet habe sich nicht klar positioniert, doch der Versuch, ihn als “Wackel-Dackel” darzustellen verlief sich. Laschet sei nicht sehr medial und Krafts Regierung habe die Gunst der Landespressekonferenz verspielt, sagen Beobachter. Die CDU punktete mit Inhalten, genauer mit dem Thema Innere Sicherheit, und griff die Kritik an Innenminister Ralf Jäger auf.
Rückblickend betrachtet seien aber die Grünen der “Hauptgegner im Wahlkampf” gewesen, “auf den am stärksten eingeschlagen wurde”, sagt Oliver Koch, Grünen-Sprecher in NRW. Auf dem Blog greenwatch.nrw werden Fake-News verbreitet, der Absender ließ sich nicht aufspüren – auch er war Fake. Christian Lindner kritisiert die Arbeit von Umweltminister Johannes Remmel mit den Worten “Remmel-Krempel” – für Koch nicht adäquat: “Fair ist es, Fehler zu benennen, aber niemanden persönlich anzugreifen. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner und seiner Position, aber nicht darum, jemanden charakterlich anzugreifen.” Letztlich gestehen sich SPD und Grüne ein, dass die anderen einfach besser waren. “Die Gegnerbeobachtung hat bei den anderen Parteien funktioniert”, sagt Koch. „Die FDP war gut vorbereitet und hat uns in die Defensive gebracht. Aus der Defensive heraus argumentiert es sich schwerer.” Das habe die Kommunikation erschwert. Irgendwann sei man in eine Spirale gekommen, in der man Sachen, die über einen gesagt wurden, nicht mehr zurückholen konnte, sagt auch der Mitarbeiter der SPD: “Zuerst hat es die Grünen getroffen, dann uns. Wenn man einmal auf der Rutsche ist, ist es schwierig, wieder von ihr runterzukommen.”
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 119 – Thema: Wichtige Macher im Umfeld der Mächtigen. Das Heft können Sie hier bestellen.