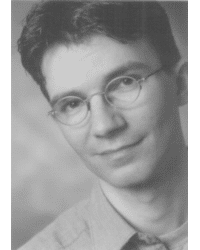Vielleicht sollte Peer Steinbrück darüber nachdenken, das TV-Duell mit Kanzlerin Merkel ins Radio zu verlagern. Der SPD-Kanzlerkandidat drängt bekanntlich auf zwei Fernsehduelle, weil er sich für wortgewaltiger hält. Doch im TV zählt nicht nur die Rhetorik – das musste schon John F. Kennedy erfahren. Im Präsidentschaftswahlkampf 1960 wurde das Fernsehduell zwischen Nixon und ihm zeitgleich auch im Radio übertragen. Die Fernsehzuschauer fanden den gebräunten Kennedy sympathischer als den kränklich-blassen und schlecht rasierten Nixon und sahen ihn als Sieger der Auseinandersetzung. Die Radiohörer urteilten anders: Ihnen erschienen die klare Sprache und die Argumentation von Nixon glaubwürdiger.
Das Radio, das Paradies für Rhetoriker, erlebt derzeit eine Renaissance: Die Hörerzahlen steigen – seit 2008 wächst die Popularität. Der Konsumerhebung „Media-Analyse“ zufolge hörten im vergangenen Jahr 78 Prozent der Deutschen täglich Radio. Zuwachs verzeichnen vor allem die öffentlich-rechtlichen Kultur-Radios sowie die Wellen mit hohem Anteil an politischen Informationen und Diskussionen. Dieser Trend findet sich auch bei den Privaten. So hat Antenne Bayern mit einem für private Sender ungewöhnlich hohen Wortanteil mehr Hörer an sich binden können. Allen Unkenrufen zum Trotz behauptet sich der Hörfunk auf einem soliden Niveau. Die Programmmacher profitieren dabei von der Zunahme der Smartphones, die nicht nur die Dauernutzung von Facebook oder Twitter ermöglichen, sondern im gleichen Maße die Dauerbeschallung durch den Lieblingssender.
Größte Reichweite am Morgen
Trotzdem vernachlässigen Politiker das Medium; dabei setzen Radiojournalisten oft und gern O-Töne ein. Am häufigsten kommen Berliner Spitzenpolitiker zu Wort. O-Töne von Landes- und Kommunalpolitikern sind dagegen selten. Wie im Fernsehen kommen im Radio Nachrichten eher zum Zug, die mehr bieten als nur trockene Fakten. Beim Medium Fernsehen entsteht dieser Mehrwert durch die Bilder, beim Radio durch O-Töne.
Hinzu kommt: Inhalte von Radionachrichten variieren über den Tag hinweg kaum. Der Bürgermeister, der schon morgens vom örtlichen Radiosender interviewt wird, hat hohe Chancen, mit seinem Zitat über den Tag hinweg immer wieder „on air“ zu sein. Die größte Reichweite kann er erzielen, wenn das Interview in der morgendlichen Primetime (6 bis 9 Uhr) stattfindet. Eine ähnlich hohe Reichweite lässt sich dann erst wieder zwischen 16 und 18 Uhr während der so genannten „Drive Time“ erzielen.
Insofern bietet eine professionellere Kommunikation in diesem Bereich große Chancen. Allerdings fehlt Politikern offensichtlich oftmals der Mut, Interviews „on air“ zu geben.
Doch wie sieht das Radio der Zukunft aus? In den USA fungieren die Radiostationen noch immer als Seismograph für die öffentliche Meinung. Auch wenn die Lokalsender inzwischen ihre Unabhängigkeit eingebüßt haben, als Stimmungsmacher haben sie wichtige Impulse gegeben – etwa beim Aufkommen der Tea-Party-Bewegung. Die Moderatoren der Talkradios verstehen sich in erster Linie als meinungsstarke Polarisierer, weniger als objektive Journalisten. So agitiert Rush Limbaugh seit Jahrzehnten am rechten Rand: Er bezeichnet Frauenrechtlerinnen als „Feminazis“ und Umweltaktivisten als „Spinner“ – ihm hören regelmäßig 20 Millionen Amerikaner zu.
In Deutschland ist eine derart drastische Polarisierung nicht zu erwarten. Die Zukunft des Mediums wird hierzulande von den technischen Neuerungen bestimmt. Längst bieten vor allem die Qualitätsprogramme Podcasts zu verschiedenen Themen an. Vermutlich wird es bald eine Art „Radio on demand“ geben, ein personalisiertes Programmangebot. In welchem Ausmaß sich dort politische Inhalte wiederfinden, ist nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch eine Frage der politischen Teilhabekultur.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Na, Klassenfeind? Ein Linker und ein Liberaler über Freundschaft zwischen politischen Gegnern. Das Heft können Sie hier bestellen.