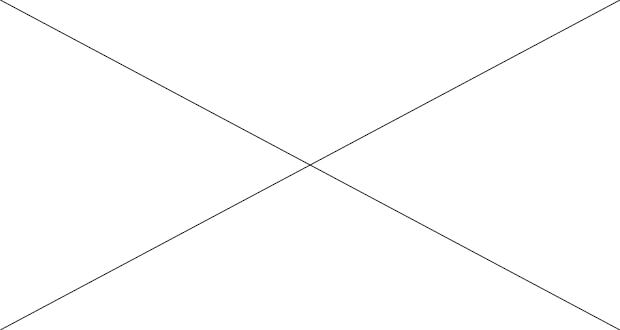Politik ist der Tummelplatz für machtambitionierte Opportunisten und Schaumschläger. Wer sich bei Wählern beliebt macht, steigt auf, nicht, wer über die größte Kompetenz verfügt. So passen Opportunisten sich Wählerwünschen an, selbst wenn sie damit die Probleme, die sich vor ihnen auftürmen, noch größer machen, und behaupten trotzdem, alles im Griff zu haben. Wer mit Ernst und dem Vorsatz in die Politik geht, dort etwas für das allgemeine Wohl zu erreichen, sieht sich schnell von Opportunisten umstellt. Deren Kernprogramm ist Populismus, nicht Problemlösung. Erobern sie Macht und zeigt sich dann, dass sie nicht zustande bringen, was sie versprochen haben, strafen die Wähler sie beim nächsten Mal ab. Sie wählen neue Populisten, die sich noch nicht in offensichtlicher Unfähigkeit verschlissen haben und die Illusion bedienen, Lasten von ihrer Klientel fernzuhalten. So bilden Wähler und Populisten im Machtspiel der Politik ihre Komplizenschaft.
Politiker müssen sich, um erfolgreich zu sein, vor allem gut darstellen können. Für Politiker ist das wichtiger als Kompetenz. Sie müssen nicht Macher sein. Sie müssen als Macher erscheinen. Was zählt, ist der Eindruck von Kompetenz. Diesen Eindruck vermitteln sie jedoch nicht, weil sie Aufgaben erledigen, nachprüfbar wie bei Managern, sondern weil sie sympathisch rüberkommen. Sympathie ist in der Politik, die auf öffentlicher Bühne mit großem medialem Brimborium stattfindet, zum entscheidenden Machtfaktor geworden.
Menschenfischer
Politiker können darauf setzen, dass hohe Sympathiewerte andere Eigenschaften, die nicht so vorteilhaft sind, in den Schatten stellen, sodass sie nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Sie profitieren bei Wählern vom »Halo«-Effekt, wie es Psychologen nennen. Der klickt bei Menschen leicht ein und das bedeutet: Wenn wir bei einem anderen eine Eigenschaft erkennen, die uns besonders wichtig ist, wie Sympathie, dann schreiben wir dieser Person automatisch andere positive Eigenschaften zu – selbst wenn wir für deren Existenz keine Belege haben. Wen wir für sympathisch halten, von dem nehmen wir meist auch an, dass er/sie intelligent ist. Umso eher, wenn die Person auch noch gut aussieht. Denken Sie an Karl-Theodor zu Guttenberg. Der galt eine Zeitlang sogar als redlicher Intellektueller. Er kassierte Zustimmungsboni auch ohne Leistung. Seine politische Hinterlassenschaft als Minister ist in der fachlichen Substanz dürftig.
Um hohe Sympathiewerte zu erzielen, müssen Politiker auf Menschen zugehen und – mehr noch – nachempfinden können, was diese Menschen von ihnen erwarten, was sie sich wünschen, worauf sie hoffen, was sie befürchten. Politiker brauchen Empathiefähigkeit. Dabei hilft ihnen praktischerweise das menschliche Gehirn. Eine besondere Rolle spielen dabei die sogenannten Spiegelneuronen. Sie gehören zu unserer genetischen Grundausstattung. Jeder besitzt sie. Aber nicht jeder nutzt sie gleich effektiv. Wenn wir Gestik, Mimik, Stimmlage anderer aufmerksam wahrnehmen, aktivieren Spiegelneuronen in unserem Kopf dieselben neuronalen Schaltkreise, die bei unserem Gegenüber aktiv sind. So können wir in den Gesichtern anderer Menschen lesen, wie es ihnen geht, was sie besonders beschäftigt, ihnen wirklich wichtig ist. Das funktioniert, weil die neuronalen Verschaltungen Hirnareale miteinander verbinden, die für »Denken« und für »Fühlen« zuständig sind, wodurch wir durch aufmerksame Zuwendung Gefühle anderer aufnehmen und simulieren. Wir können ähnlich wie sie empfinden, nach-empfinden, emotionalen Gleichklang herstellen.
Mit Intelligenz hat das übrigens nichts zu tun. Es ist eine natürliche Veranlagung, die uns sozialfähig macht. Entwicklungsgeschichtlich war diese Fähigkeit schon vorhanden, wie der amerikanische Soziologe Jonathan H. Turner herleitet, bevor Menschen Sprache entwickelten. Sie war, so Turner, der wesentliche Antrieb für ein Zusammenleben in Gemeinschaften, dafür, dass Verständnis füreinander entstand, sich gemeinsame Werte und Moralvorstellungen entwickeln konnten und soziale Strukturen, die für Sicherheit und Bestand der Gemeinschaft sorgten.
Politiker tun gerne so, als verfolgten sie keine persönlichen Interessen. Sie behaupten, es ginge ihnen »um die Sache«, und diese Sache soll die Sache ihrer Wähler sein. Politiker von sogenannten „Volksparteien“ reklamieren sogar für das Volk insgesamt einzutreten. Politiker präsentieren sich als Sachwalter von Interessen und tun so, als ob die eigenen Interessen identisch wären mit den Interessen ihrer Wähler. Die sollen sich mit ihren Sorgen und Wünschen gut vertreten und aufgehoben fühlen. Wer das vermitteln kann, kommt an.
Clintons Erfolgsgeheimnis
Von den vielen Politikern, denen der Autor in seiner Zeit als Journalist persönlich begegnet ist, kann das der ehemalige US-Präsident Bill Clinton am besten. Er blickt den Menschen tief in die Augen, schüttelt nicht nur, sondern hält Hände. Er hört zu, nimmt auf, Einzelne, selbst in Menschenmengen. Er kann Menschen, die er zufällig trifft, so anschauen, als gäbe es für ihn nichts, was für ihn in diesem Augenblick wichtiger wäre. Tatsächlich kann er vergessen, was er seinem aktuellen Programm zufolge eigentlich zu tun hätte. So bringt er die Zeitplanung ständig durcheinander, macht seine Politbegleiter nervös und kommt andauernd irgendwo zu spät, auch bei wichtigen politischen Terminen. Im direkten Zugang zu Menschen synchronisiert Clinton Empfindungen. Erst in dieser Fähigkeit zeigt sich wahres Verständnis. Wenn Clinton seinen Zuhörern versichert, er empfinde ihr Sorgen, Nöte und Hoffnungen, zeigt sich sein Mitgefühl in seinem Gesicht. Die Zuhörer nehmen es auf. In solcher Begegnung gilt, was der Arzt und Analytiker Michael Lukas Moeller beschrieb: Das Unbewusste kommuniziert mit dem Unbewussten irrtumsfrei. Clinton fürchtet, leidet, hofft in diesem Moment mit. Und schüttelt diese Gefühle wieder von sich ab, wenn er sie nicht mehr braucht. Auch das gehört zu seinem Erfolg – die Fähigkeit, sich wieder abzugrenzen.
Je größer und differenzierter die Gefühlspalette eines Politikers, umso differenzierter kann er die vielfältigen Gefühle anderer empfangen und sich mit ihnen in Einklang setzen. Gerhard Schröder kann das auch gut. Aber so einlassen wie Clinton kann er sich nicht. Bei Leuten wie Schröder ist die Aufmerksamkeit geteilt. Das heißt für den Einzelnen: Sie ist nicht ganz echt. Gleichzeitig halten Menschen wie Schröder nämlich ihr Umgebungsradar aktiv, das ihnen Hinweise gibt, ob nicht irgendetwas geschieht, irgendwer kommt, dem mehr Aufmerksamkeit zu widmen ist – weil er im Machtspiel als bedeutendere Figur wahrgenommen wird. Schröder – oder auch Lafontaine – haben deshalb mitunter auch etwas Fahriges und damit für Zuhörer Suspektes. Sie senden unbewusst Signale, dass sie nicht ganz dabei sind, dass anderes ihnen wichtiger ist. Sie verfolgen ihre eigene Agenda, angetrieben von ihrem Willen zur Macht.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Wir wollen rein – Bundestag 2013. Das Heft können Sie hier bestellen.