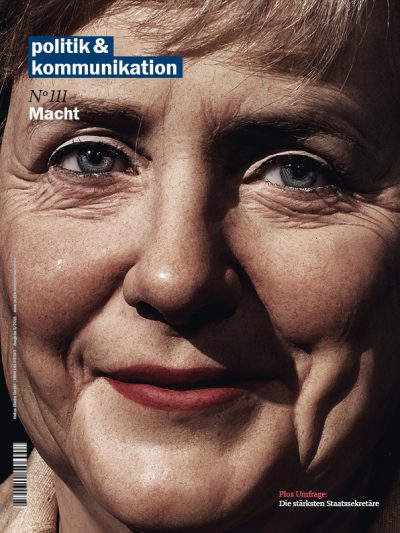Nein, sein Vorname war nicht “Mahatma”. Auch sonst führt die Stilkone des sanften Friedensgurus, der das Empire beschämte und Indien gewaltlos frei protestierte, in Mythennebel. Das Kolonialregime des britischen “Raj” scheint St. Gandhi nur mit Moral, Charisma und Gesten abgeräumt zu haben. Der echte Mohandas Gandhi schwebte nie erhaben über dem Morast der Tagespolitik. Seine Großleistung war nicht der Abzug der Briten. Es war der Aufbau einer Massenpartei. Gandhi war Vollblutpolitiker: zäh, stimmungsfühlig, wetterwendisch, widersprüchlich, gerissen und für Lord Willingdon, Vizekönig in New Delhi, der “machiavellistischste kleine politische Gauner, den ich je traf.”
Machtkämpfe verlor er so oft, wie er sie gewann – gegen den “Raj” und im eigenen Lager. Ihm flogen die Herzen der Massen zu. Aber ihre Verehrung war meist hohl. Mehrmals trat er von der Bühne ab und platzte zurück in die Szene. Als Organisator war er pingelig; bei Inhalten setzte er auf “Experimente mit der Wahrheit”. Er war ein Meister der Symbol-Kommunikation. Sein größtes Symbol war er freilich selbst. Er war tief spirituell. Aber Gandi nannte sich selbst “professioneller Widerständler” und seine Mission “eine Propagandabewegung reinsten Typs”.
Als Anwalt der indischen Minderheit in Südafrika (1893-1914) gewann Gandhi ein Macherimage. Seine Marke: Gewaltfreier Widerstand. 1915 stieß er zum Indischen Nationalkongress. Der betuliche Eliteklub empfahl sich London als seriöse Lobby für Mitbestimmung. Als die Briten, statt Autonomieversprechen einzulösen, Bürgerrechte kassierten und Proteste niederschossen, kamen die Parteigranden unter Druck. Spaltung, Radikalisierung und Bedeutungsverlust drohten. Ins Vakuum trat Gandhi. Er biss Rivalen weg, managte die Mikropolitik der Gremien und Plenarbeschlüsse, baute Parteibezirke um und füllte leere Kassen. Fabrikanten und Bankiers finanzierten ihn trotz seiner Antiindustrie-Rhetorik. Parteifreunde bestaunten sein “Genie als Geldsammler”. Sozialisten ätzten, er sei ein “Maskottchen der Bourgeoisie”.
Er öffnete die Grenzen der alten Politikwelt
Doch er reiste volkstümlich, pries Solidarität mit den Armen, baute Selbsthilfeprogramme auf. Sein Verzicht auf Machtsinsignien, sein Leben als Asket, seine Religiosität und schlichten Reden gewannen das Vertrauen einfacher Leute. Doch “aus den untersten Schichten erhielt Gandhi kein reales politisches Echo, wenn damit gemeint ist, für das Ziel des Machtgewinns zu planen, zu organisieren und sich Disziplin zu unterwerfen”, so die Historikerin Judith Brown. Gandhis Stärke waren Hunderttausende Neumitglieder der Mittelklasse bisher inaktiver Regionen. “Er öffnete diesen latenten Kräften die Grenzen der alten Politikwelt.” Gandhis weitere Machtquellen im Kongress waren ein wackliges Hindu-Moslem-Bündnis und ein Parteiestablishment, das “ihn für eine gute Wette hielt”, so Brown. Das alles war ein Kartenhaus, wie sich 1920-22 zeigte. Er rief zu Nichtkooperation mit Behörden und Boykotts von Importgut und Wahlen auf. Millionen folgten, doch ihm entglitt die Kontrolle. Es kam zu Morden und Krawallen. Er brach die Kampagne ab. Er wollte gute Ziele nicht mit falschen Mitteln erreichen. So verspielte er seine Führung. Gandhi ging ins Gefängnis, die Partei wieder konstitutionelle Wege.
Der Wind drehte sich 1929-30. Der Marsch durch die Institutionen blieb fruchtlos, mit zivilem Ungehorsam jedoch hatten einige Bezirke Erfolge. In London regierte Labour taumelnd durch die Weltwirtschaftskrise. Die Lage schien günstig für eine Kampagne gegen den “Raj”. Altmeister Gandhi erhielt einen Blankoscheck. Bald zweifelten alle, ob der 60-Jährige noch bei Trost sei. Als Zünder der Machtprobe erkor er ein Randthema: das Staatsmonopol zur Salzherstellung und die Salzsteuer. Im Sinn hatte Gandhi eine Art Boston Tea Party.
Er beschrieb die “inhumanste Kopfsteuer, die sich Menschengeist ausdenken kann”. Im heißen Klima sei Salz existenziell. Der Monopolpreis des Minerals verschärfe das Armutselend. Das Regime erplündere sich 700 Prozent Profit, es “stiehlt dem Volk das Salz und lässt es für das Diebesgut schwer zahlen.” Als Akt der Rebellion biete sich an, Natursalz zu machen. Jeder könne Salzwasser sieden, Salzkörner sammeln, Salz kaufen, verkaufen, bewerben. Die Strafen für Rechtsbruch seien tragbar. Das ermögliche breite Beteiligung und werde den “Raj” zu absurden Kontrollen und Repression nötigen. In der Tat: Bald saßen 60.000 Inder hinter Gittern, nur weil sie mit Salz hantiert hatten. Das Drama im Frühjahr 1930 entfaltete sich als Dreiakter. Zu Fuß marschierte Gandhi mit 80 Mann 340 Kilometer von seinem Aschram bei Ahmedabad zur Küste. Die lange Dauer von 24 Tagesetappen sollte die Spannung aufladen. Akt zwei: Gandhis Griff in den Sand (“Mit diesem Salz erschüttere ich das Fundament des Empire!”). Akt drei: an allen Küsten Massenaktionen, Transport der Konterbande ins Inland und Verkauf, Belagerung britischer Meersalzwerke.
Moralische Kriegsführung
Als “Meisterstück der moralischen Kriegsführung” (Susmita Arp) schaffte es der Salzmarsch von Berlin bis New York in die Schlagzeilen und Kinowochenschau. Gandhi sagte: “Ich will die Sympathie der Welt in diesem Kampf des Rechts gegen die Macht.” Er bekam sie. Seine Kampagne lieferte den Stoff für dramatische Stories. Etwa am Salzwerk Dhrasana, als 2500 Gandhisten wortlos vor den Polizeikordon traten, um sich “methodisch zu blutigem Brei prügeln” zu lassen, berichtete UPI-Agenturmann Webb Miller. “Nicht einer erhob nur den Arm, um sich zu wehren.” Millers Reportage löste rund um den Globus Proteste gegen England aus.
Gandhis tapfere Sturmtruppen waren spirituell und taktisch trainiert. Basis aller Macht, so Gandhis Doktrin “Satyagraha”, sei freiwillige Kooperation. Wer bereit sei, alle Strafen für Ungehorsam zu erleiden, hole sich die Macht zurück. Es stellte das Regime vor ein Dauerdilemma: Ließ es überlegene Wucht auf die gewaltlosen Gesetzesbrecher krachen, entlarvte es sich als Unterdrücker. Tat es das nicht nicht, war das Gesetz perdu. Die Folge: ständig unklare Machtverhältnisse. “Gandhi war ein außergewöhnlicher Politikstratege”, so der Widerstandsforscher Gene Sharp. Er übte “politisches Jiu-Jitsu, das die Stärke der Inder maximierte und die Macht der Briten in einen Nachteil verwandelte.” Ein Jahr lief die Kampagne, dann war der Vizekönig mürbe. Lord Irwin holte Gandhi aus der Haft und verhandelte wochenlang persönlich beim Tee. “Widerlich” fand es Winston Churchill, wie der “halbnackte Fakir” im Regierungspalast “gleichgestellt mit dem Vertreter der Krone parliert.” Für Amnestien und nur winzige Abstriche am Salzrecht blies Gandhi die Kampagne ab. Ein Ausverkauf? Downing Street lud den Staatsfeind zum Runden Tisch. “Als er in London auftauchte”, so David Arnold, “war er endgültig eine Weltikone.” Das US-Magazin “Time” hob ihn als “Mann des Jahres” aufs Cover. Seine größte Machtquelle hatte Gandhi voll erschlossen: Prestige.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation II/2015. Das Heft können Sie hier bestellen.