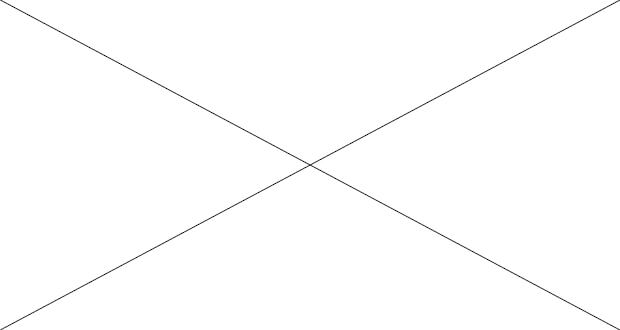Wer Auskünfte über Karl-Theodor zu Guttenberg suchte, konnte auf seiner Internetseite bis vor kurzem Bilder mit Begleittexten finden, die seine Wertvorstellungen resümierten: „Politik als Dienstleistung zu begreifen, ist für mich ein Grundverständnis.“ Oder: „Richtschnur meines Handelns ist Prinzipienfestigkeit und Grundsatztreue.“ Seit seinem Rücktritt sind die Bilder dieselben geblieben, die Sätze aber sind nun verschwunden. Dabei lohnt es, sie mehrfach zu lesen, zum Beispiel den letzten Satz. Denn was ist eigentlich „Prinzipienfestigkeit“? Dasselbe wie Grundsatztreue. Und was ist Grundsatztreue? Guttenbergs Satz, vorgetragen im Bekenntniston eines „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, besagt der Sache nach nicht viel mehr, als dass die Grundlage die Basis des Fundaments sei. Doch entscheidend ist, was er rhetorisch signalisiert: dass dieser Sprecher sich aufrichtig und geradlinig äußere, ohne Umschweife und rhetorische Mätzchen. Das ist ein wesentlicher Zug in Guttenbergs Rhetorik: dass sie sich selbst unsichtbar machen will. Oft sind es darum nur kleine Wendungen, in denen sich ihre Absicht verrät, das Kalkül der Unschärfe. Wer ihm auf die Spur kommen will, muss ins Detail gehen. Man muss kleinlich werden, um hier die großen Linien zu entdecken.
Rhetorik der kalkulierbaren Unschärfe
„Der Vorwurf, meine Doktorarbeit sei ein Plagiat, ist abstrus“, hat Guttenberg in seiner ersten Stellungnahme erklärt, und: „Ich bin gerne bereit zu prüfen, ob bei über 1200 Fußnoten und 475 Seiten vereinzelt Fußnoten nicht oder nicht korrekt gesetzt sein sollten.“ Den Vorwurf nimmt er auf, indem er ihn zur Unkenntlichkeit verzerrt. Nicht nur ist das Wort „vereinzelt“ angesichts des Vorwurfs stark untertrieben – es ist vor allem das „oder“, das den Unterschied verschleiert, auf den doch alles ankommt. Denn besteht nicht zwischen Fußnoten, die lediglich „falsch gesetzt“ sind, und solchen, die „nicht gesetzt“ sind, derselbe Unterschied wie zwischen dem Goldring, den der Juwelier in die falsche Schublade gelegt hat, und dem, den er stillschweigend mitgehen lässt? Irreführend ist ja schon die Unterstellung, der Streit habe sich nur um fehlende Fußnoten gedreht. Man stelle sich nur für einen Augenblick vor, Guttenberg hätte alle Fremdtexte mit korrekten Fußnoten nachgewiesen: die Einleitung ein Leitartikel aus der Zeitung, ein halbes Kapitel ein Gutachten des Bundestags – da wäre dann alles in Ordnung gewesen?
Als diese Ausweichstrategie wenige Tage später angesichts der erdrückenden Textbelege nicht mehr zu halten ist, ändert Guttenberg an ihr erstaunlicherweise nichts. „Ich stehe dazu“, sagt er über seine Arbeit, „aber ich stehe auch zu dem Blödsinn, den ich geschrieben habe.“ Das überraschendste Wort ist wieder das unauffälligste: „aber“. Die Versicherung, er stehe zu seiner Arbeit, bezieht sich ja schon auf alles, was sie enthält. Das „aber“ suggeriert, dass nur einzelne Passagen in Rede stünden, Blödsinn halt, wie er jedem Menschen unterlaufen kann. Der aber war gar nicht gemeint; im Gegenteil ging es darum, dass die Arbeit durchaus vernünftige Texte enthalte – die nur eben nicht Guttenbergs eigene waren.
Dieses Verfahren zieht sich leitmotivisch durch seine Äußerungen bis zur Rücktrittserklärung. Er habe Fehler gemacht, gesteht er ein ums andere Mal, und Schwächen gezeigt; auch als „allzu menschlich“ zeigt er sich gern. Vor dem Bundestag bedauert er, dass „man eine offensichtlich sehr fehlerhafte Doktorarbeit geschrieben hat“. Da ist nicht nur das „man“ gemogelt, weil es den Sprecher rhetorisch jener Verantwortung entzieht, die er doch übernehmen will; zweideutig ist auch das „offensichtlich“: Meint es „offenkundig“ oder „anscheinend“? Nicht anders der Satz von den „gravierenden handwerklichen Fehlern“ – als habe er seine eigentlich guten Gedanken nur unbeholfen präsentiert. Im Fernsehen versichert er kurz vor dem Rücktritt, seine Arbeitskraft sei „vollends gegeben“, und fügt hinzu: „Ich habe dieses Amt auszufüllen – und fülle das mit Freuden auch entsprechend aus.“ Seine Arbeitskraft sei vollständig gegeben, meint er, das „vollends“ ist grammatisch falsch, gibt der Äußerung aber den Ton des Gewählten und Durchdachten. Das „entsprechend“ wiederum bezieht sich auf gar nichts, es hängt in der Luft, sinnlos und bedeutungsvoll.
Den Höhepunkt dieser Rhetorik der kalkulierten Unschärfe markiert die Rücktrittserklärung vom 1. März, die – immerhin handelt es sich um einen schriftlich sorgsam vorbereiteten Text – eine genaue Lektüre erlaubt. Sein Ausscheiden aus einem „Amt […], an dem das ganze Herzblut hängt“, begründet Guttenberg mit einem Pathos, das so verräterisch schief ist wie diese Metapher: „Ich gehe nicht alleine wegen meiner so fehlerhaften Doktorarbeit“, erklärt er, „wiewohl ich verstehe, dass dies für große Teile der Wissenschaft ein Anlass wäre. Der Grund liegt im Besonderen in der Frage, ob ich den höchsten Ansprüchen, die ich selbst an meine Verantwortung anlege, noch nachkommen kann“. Auf das „nicht alleine“ folgt hier nicht das zu erwartende „sondern auch“, sondern die preziöse Wendung „im Besonderen“. Nicht zwei unterschiedliche Gründe werden damit genannt, sondern eigentlich nur ein einziger. Das Besondere, das den Minister zum Rücktritt zwingt, folgt aus dem höchsten Anspruch, den er an seine Verantwortung anlegt. Hier kommt die Grammatik gleich mehrfach ins Schlingern – und erweist sich gerade so als rhetorisch sehr wirksam. Der Redner erhebt keine Ansprüche an sich selbst, sondern (mit einem Ausdruck, den es im Deutschen gar nicht gibt) er legt Ansprüche an sich an: als handle es sich um Maßstäbe. Und nicht gerecht werden will er ihnen, sondern „nachkommen“. Auch dieser Ausdruck ist ungrammatisch; aber er überblendet die Ansprüche suggestiv mit den Aufgaben. Das Ergebnis der zweifachen semantischen Inkongruenz ist die Unterstellung, dass die Kritiker den Redner nicht nur davon abhalten, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern auch davon, seinen Aufgaben nachzukommen; Aufgaben, an deren Wahrnehmung er strengste Maßstäbe anlegt, wenn es auch andere als die „der Wissenschaft“ sind.
Das ist vielleicht der kennzeichnendste Zug dieses Textes: dass er wie von selbst aus der Demutsgeste in den Angriff übergeht, dass er noch die Selbstkritik ins Eigenlob umbiegt, aber im Gestus der Bescheidenheit, Treue und Verantwortung – „mir war immer wichtig“, sagt er über seine „Schwächen und Fehler“, „diese vor der Öffentlichkeit nicht zu verbergen“. Aber ist nicht das Plagiat ein einziger Versuch, befürchtete Schwächen und Fehler zu verbergen? Er fährt fort: „Deswegen habe ich mich aufrichtig […] entschuldigt.“ Schon in seiner Bundestagserklärung hat er sich selbst die angemessene „Demut“ attestiert. Nicht mehr das Vergehen steht im Mittelpunkt solcher Sätze, sondern nur noch die Aufrichtigkeit und Demut dessen, der sie sagt. Wer aber so vorbildlich auftritt, der hat nicht kritische Nachfragen und Vorhaltungen verdient, sondern mindestens Mitleid und Respekt. Nichts anderes besagt der wiederum verklausulierte Satz, der diese Worte enthält. Er dürfe keinen Respekt erwarten, sagt Guttenberg, und beim ersten Hören klingt das so, wie seine Kritiker es in seiner Rücktrittserklärung gern hören möchten: als habe er einen moralischen Anspruch verwirkt. Tatsächlich aber, das zeigt sich auf den zweiten Blick, sagt er genau das Gegenteil: „Wer sich für die Politik entscheidet, darf, wenn dem so ist, kein Mitleid erwarten. Das würde ich auch nicht in Anspruch nehmen. Ich darf auch nicht den Respekt erwarten, mit dem Rücktrittsentscheidungen so häufig entgegengenommen werden. Kein Zweifel, das „darf auch nicht“ zielt hier auf die harte politische Welt, die dem Ehrenhaften leider das ihm eigentlich Zukommende verweigert; noch in der stoischen Haltung aber beweist sich seine moralische Überlegenheit.
Sprache der Scheinheiligkeit
Die Kritik hingegen lenkt der Redner vollständig auf seine Kritiker zurück. Mit Empörung sieht er, dass „die öffentliche und mediale Betrachtung fast ausschließlich auf die Person Guttenberg und seine Dissertation statt beispielsweise auf den Tod und die Verwundung von 13 Soldaten abzielt“. Diesmal steckt die Unterstellung im „statt“: Als habe die Öffentlichkeit nur die Wahl gehabt, entweder über Guttenbergs Verfehlungen zu debattieren oder über die Soldaten in Afghanistan – wie denn auch „wochenlang meine Maßnahmen bezüglich der ,Gorch Fock‘ die weltbewegenden Ereignisse in Nordafrika zu überlagern schienen“. Es ist, als wiese ein ertappter Dieb darauf hin, dass der Hunger in der Welt doch ein viel ernsteres Problem sei als sein kleiner Diebstahl. Mehr noch, perfider noch: Guttenberg formuliert seine Behauptung so, als habe darüber hinaus jeder Angriff auf ihn faktisch auch diejenigen geschwächt, die er „die mir Anvertrauten“ nennt.
Was hier suggeriert wird, ist kein Schuldbekenntnis, sondern eine Dolchstoßlegende. Ihr zufolge hat nicht der Minister unanständig gehandelt, weil er etwa gelogen und betrogen hätte, ohne Anstand sind vielmehr diejenigen, die ihm das vorwerfen. Denn sie sind damit unweigerlich zugleich der kämpfenden Truppe in den Rücken gefallen, diesen „großartigen Truppen, die mir engstens ans Herz gewachsen sind“ (es ist das „engstens“, das hier die Pose decouvriert): „Nachdem dieser Tage viel über Anstand diskutiert wurde, war es für mich gerade eine Frage des Anstandes, zunächst die drei gefallenen Soldaten mit Würde zu Grabe zu tragen“ – das ist die Dolchstoßlegende in ihrer abgeschmacktesten Form. Über die Linguistik der Lüge hat der Sprachwissenschaftler Harald Weinrich 1966 ein berühmtes Buch geschrieben. Karl-Theodor zu Guttenbergs Äußerungen zur Plagiatsaffäre führen eine Sprache der Scheinheiligkeit.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Think-Tanks – Ihre Strategien, ihre Ziele. Das Heft können Sie hier bestellen.