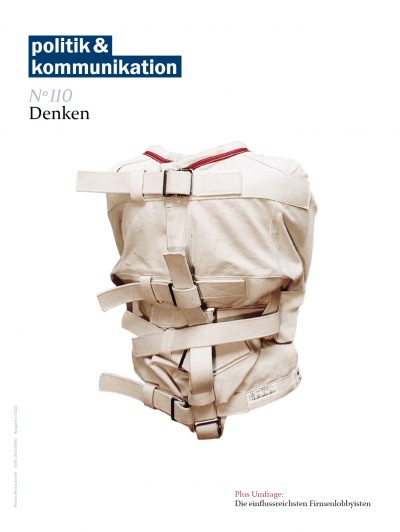“Perlentaucher” arbeitete zeitweise im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Diesen Geldgeber hat das Online-Magazin inzwischen verloren, heute liefert Chervels Team die tägliche Feuilleton- und Debattenrundschau für “Spiegel Online”. Chervel empfängt in seinem bescheidenen Drei-Raum-Büro im Erdgeschoss eines Plattenbaus in Berlin-Mitte.
Herr Chervel, ich will gar nicht abschätzen, wie viele Hundert Zeitungsseiten hier täglich durchgeblättert werden müssen, damit deren Inhalt beim “Perlentaucher” zusammengefasst werden kann. Lesen Sie überhaupt noch gerne Zeitung?
Thierry Chervel: Ja klar. Aber ich lese anders, kaum noch auf Papier, sondern als E-Paper. Und privat eher andere Ressorts, vor allem den Wirtschaftsteil der “FAZ”. Viele der aktuellen gesellschaftlichen Umwälzungen spielen sich in der Sphäre der Wirtschaft ab und nicht so sehr in der kulturellen.
Welche?
Das Internet und die Netzökonomie betreffen uns alle. Viele Journalisten glauben ja, die Medienkrise sei was Exklusives, aber das ist natürlich Blödsinn. Sogar die Arbeit von Landwirten wird durch das Internet tangiert. Es gibt inzwischen Kuhherden, die per Satellit überwacht werden.
Lassen Sie uns trotzdem über das Feuilleton sprechen. Kürzlich hat “Die Zeit” einen Text veröffentlicht, in dem steht, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Kann man heute noch eindeutig zuordnen, welche Zeitung welche Meinung bei einer bestimmten Sache vertreten wird?
Ich glaube schon, dass es noch politisch-publizistische Profile gibt, die man auch erkennt. Allerdings ist es nicht mehr so eindeutig wie früher. Vielleicht hat das mit der Großen Koalition zu tun.
Das hat uns alle im Griff, meinen Sie?
Nun ja, ich meine die Käseglocke und das Motto der Alternativlosigkeit, die sich automatisch einstellen, wenn Parteien, die zwei Drittel der Wähler repräsentieren, den Staatsapparat beherrschen. Das prägt die Debattenkultur. Es gibt große Bereiche der Gesellschaft, in denen man schon sehr subtil sein muss, wenn man unterschiedliche Positionen herausarbeiten will. Starke Differenzierungen gibt es kaum noch, sehr schnell gerät man unter Populismusverdacht oder wird zum Außenseiter. Wenn Debatten stattfinden, dann eher innerhalb der Parteien, nicht zwischen ihnen. Die Medien inszenieren Debatten nicht mehr wie früher. Das hat auch mit Geldmangel zu tun: Statt Autoren von außen schreiben zu lassen, schreiben die Redakteure selbst – das spart Geld.
Sie vermissen also echte Debatten. Wie sollten die denn aussehen, idealtypisch?
Eine Debatte bedeutet Streit. Und der muss wehtun. Es muss ein neuralgischer Punkt getroffen werden, erst dann wird leidenschaftlich diskutiert. Nur, wenn es an die Substanz geht, ist es ein richtiger Streit.
Diese Diskussionen gibt es ja, auf der Straße zumindest, sicher auch im Privaten, in Kneipen. Journalismus, so lernt man es, ist das Selbstgespräch einer Gesellschaft. Spiegeln Medien noch die Meinungsvielfalt?
(überlegt) Ich bin nicht völlig sicher, ob man das sagen kann. Ich will ein Beispiel aufgreifen, in das wir selbst verwickelt waren. Die Urheberrechtsdebatte…
… als Ihnen vor einigen Jahren von großen Medien wie “Süddeutscher Zeitung” und “FAZ”, auch vor Gericht, vorgeworfen wurde, deren geistiges Eigentum wirtschaftlich auszubeuten. Der Richter bestätigte den Vorwurf auch teilweise.
Zum kleinsten Teil! 90 Prozent der Prozesskosten mussten die Kläger zahlen. Jedenfalls waren die Zeitungen in dieser Debatte selbst Partei, und das Thema wurde entsprechend aufbereitet, gegen uns. Das ist ein generelles Problem, dieser Kulturpessimismus in Sachen Internet bei den deutschen Zeitungen und auch in den mächtigen Öffentlich-Rechtlichen. Das hängt damit zusammen, dass eigene wirtschaftliche Interessen berührt werden. Diese Kultur trägt dazu bei, dass es in Deutschland kein originäres Internetmedium gibt, es gibt nur Ableger von Traditionsmedien. Das wiederum führt dazu, dass Debatten nicht so breit geführt werden können wie beispielsweise in den USA, wo es unzählige erfolgreiche Online-Angebote gibt, die ihren Beitrag zur öffentlichen Meinung leisten.
Welche Rolle kann der “Perlentaucher” bei einer Debatte spielen? Mögen Sie das Wort Trüffelsucher in diesem Zusammenhang?
Ursprünglich sollte das Angebot sogar “Trüffel” heißen, der Name war aber 1999 leider schon vergeben. Trüffelsucher schreibt dem Internet eine Dimension der Tiefe zu, das gefällt mir gut. Und das ist mit “Perlentaucher” auch gegeben.
Man kann das Wort auch negativ wenden. Ihnen wurde ja schon oft vorgeworfen, Sie machten Geld mit den Gedanken anderer. Das tut einem Journalisten doch weh, oder?
Ja, zumal es auf Journalisten selbst zutrifft, die heute so tun, als seien sie die originäre und Internetmedien die sekundäre Quelle. Aber sie sind selbst schon sekundär. Mit dieser Argumentation kann man Journalismus allgemein diffamieren: Schließlich ist es seine Aufgabe, fremde Inhalte zusammenzufassen und aufzubereiten.
War das, was Sie heute erreicht haben, Ihr Ziel, als Sie vor 15 Jahren mit “Perlentaucher” anfingen?
Ich denke, wir hatten größere Erwartungen. Es ist dorniger gewesen, als wir gehofft hatten. Ich bin heute froh, dass wir unsere Nische gefunden haben. Aber Dynamik gibt es bei Internetmedien nicht. Die traurige Erkenntnis der vergangenen 15 Jahre ist, dass es nicht wirklich ein Geschäftsmodell für Information gibt.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Denken. Das Heft können Sie hier bestellen.