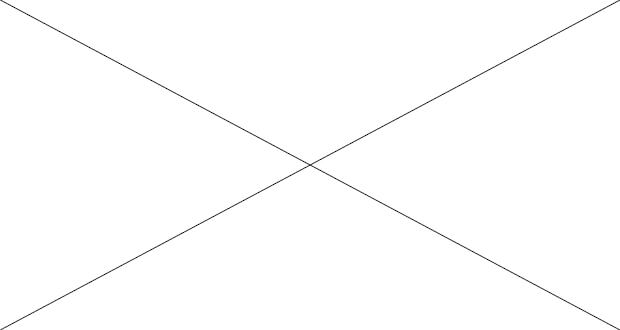Lange vorbei sind die Zeiten, als Journalisten für Politiker nur „Randfiguren der holzverarbeitenden Industrie“ waren – so der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt, der diesem Berufsstand selbst angehört hatte. Die Medien sind spätestens in der Berliner Republik zu einem politischen Faktor aus eigenem Recht geworden. Das hat auch, aber nicht nur, mit schierer Masse zu tun: Rund 2500 Journalisten berichten aus Berlin über Politik. Über 60 nationale und internationale Fernsehstationen unterhalten Berliner Büros. Hinzu kommen die Korrespondenten von über 90 regionalen deutschen Tageszeitungen und die Berliner Medien.
Diese geballte Präsenz verschafft den Medien in der Hauptstadt ein enormes Gewicht. Ihre zunehmende Dominanz lässt sich aber auch aus zwei weiteren Motiven erklären: Durch die Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft sind Medienunternehmen zu bedeutenden ökonomischen Akteuren geworden, deren Anliegen die Politik nicht überhören darf. Und in der Mediengesellschaft fungieren Medien als die primären Vermittlungsinstanzen für Politik, deren Regeln nicht nur die Politikdarstellung, sondern auch die Politikherstellung immer mehr dominieren. Ein neuer Schub der Medialisierung hat die stets prekäre Balance zwischen Politik und Medien endgültig zugunsten der letzteren verschoben. Seit den 80er Jahren – nach der Einführung des dualen Rundfunks – geriet die Politik immer stärker in den Sog von Medienerwartungen, ohne sich diesen wirksam widersetzen zu können.
Gleichzeitig hat sich das Medienhandeln so beschleunigt, dass die Politik nicht mehr schnell genug jenen Stoff liefern kann, den die Medien in unendlicher Abfolge brauchen. Deswegen haben diese sich mehr und mehr von der politischen Prozesslogik abgekoppelt. Sie orientieren ihre Berichterstattung zunehmend an ihrem eigenen Funktionscode – und nicht länger an den Vorgaben, die aus dem politischen System kommen. Nicht mehr die politische Agenda, sondern das Eigenkalkül der Medien bestimmt mehr und mehr die Berichterstattung. Politisches und Persönliches, Ernstes und Unterhaltsames wird in einer Art und Weise abgemischt, die stark von den Aufmerksamkeitsregeln des Boulevards bestimmt ist. „Storytelling“, das möglichst unterhaltsame Erzählen einer Geschichte, ist für die Auswahl von Nachrichtenstoff unterhalb der Ebene der „Breaking News“ vielfach wichtiger als Inhalte. Personalisierung und Skandalisierung werden auch dort zu Ankerpunkten der Berichterstattung, wo es um routinehafte, nicht personengebundene Sachfragen geht. Unterhaltung gewinnt immer mehr an Bedeutung, und damit siegt die Dominanz des Formats endgültig über den Inhalt. Hinzu kommt: In der modernen Medienwelt sind Prominenz und Elite austauschbar geworden. Tagtäglich können die Redaktionen zwischen Boris Becker und Angela Merkel wählen, selbst seriöse Zeitungen füllen ihre Titelseiten mit der Eurovisions-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut. Aus Sicht mancher People-Magazine sind Politiker – die Bundeskanzlerin und den Verteidigungsminister einmal ausgenommen – durchweg B-Promis, die nur dann zum Zuge kommen, wenn Mangel an Geschichten aus der A-Klasse der Stars und Sternchen herrscht. Durch diese Gleichsetzung von Einfluss und Bekanntheit haben die Medien einen Vorteil: Sie sind von der Politik als Stofflieferant unabhängig geworden.
Orchestriert wird dieser Prozess von einem Strukturwandel der Medien. Durch die task-force-mäßige Organisation von Redaktionen und Ressorts, einen zunehmend spürbaren Einfluss des Boulevards und die Vervielfältigung der Medienkanäle bei sinkenden Personalzahlen in den Redaktionen wird Medienberichterstattung zunehmend beides: oberflächlich in den Inhalten und massiv konzentriert in der Intensität. Es kommt zur Vortäuschung publizistischer Pseudo-Vielfalt, etwa wenn die Politikressorts von „Berliner Zeitung“, „Frankfurter Rundschau“ und „Kölner Stadtanzeiger“ nur noch eine gemeinsame Redaktion für Parlamentsberichterstattung unterhalten. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat seinen politischen Informations- und Analyse-Anspruch weitestgehend aufgegeben und fungiert mehr und mehr als Service- und Infotainment-Provider. Die konjunkturelle Medienkrise und die Strukturkrise der Printmedien haben diesen Prozess beschleunigt. Die Folge ist Qualitätsverlust bei gleichzeitiger Verdichtung der Kommunikation.
Die Politik hat sich auf diesen gewachsenen Medieneinfluss längst eingestellt. Sie ist in den vergangenen 20 Jahren telegener geworden. Die besten Aussichten auf ein politisches Spitzenamt hat heute, wer im Fernsehen gut rüberkommt. Doch auch eine Gegenbewegung ist zu beobachten: Die Politik zieht sich vor den allgegenwärtigen Medien zurück, verlagert ihr Kerngeschäft in Hinterzimmer, die vor Medienberichterstattung sicher sind. Wirklich wichtige Entscheidungen – etwa Gerhard Schröders Entschluss zu Neuwahlen im Mai 2005 – werden im kleinsten Kreis vorbereitet und dann zu einem genau definierten Zeitpunkt handstreichartig öffentlich gemacht. Man will mit dieser Taktik um jeden Preis verhindern, dass Entscheidungen in den Medien wochenlang „zerredet“ werden.
So führt die immer stärkere mediale Ausleuchtung der politischen Bühne zu dem paradoxen Effekt, dass das Politische sich zurückzieht, bevor der Scheinwerfer es erfassen kann. Ob die pikanten Abwägungen der rot-grünen Regierung im Irak-Krieg im Hinblick auf Überflugrechte und den BND in Bagdad oder der konspirative Deal von Schwarz-Gelb mit den Atomkonzernen: Die Angst der Politik vor der Skandalisierung ihrer Entscheidungen führt zu einem Transparenzverlust demokratischer Politik. Immer häufiger zu beobachten ist auch eine Zweiteilung des politischen Personals in Verkäufer und Entscheider: Während die einen vor der Kamera Beschlüsse verkünden, bereiten die anderen im Hinterzimmer die nächsten Entscheidungen vor. Leider jedoch sind – nichts ist perfekt – die Verkäufer nicht immer darüber informiert, was die Entscheider zwischenzeitlich schon entschieden haben.
Die Politik hat nach wie vor kein Mittel gefunden, den Ansprüchen der Medien ein eigenes, generisches Bild des Politischen entgegenzusetzen. Sie überlässt den Medien die Definition darüber, was als gesellschaftlich relevantes Problem zu betrachten ist und verzichtet weitgehend darauf, eigene Handlungsfelder zu thematisieren. Um überhaupt Zugang zur Öffentlichkeit zu finden, imitiert die Politik die Aufmerksamkeitsregeln der Medien – oft um den Preis der Selbstaufgabe. Umgekehrt gilt, dass die Medien die volle Komplexität des politischen Prozesses in der Aushandlungsdemokratie fast nie adäquat abbilden können. Diesen Effekt macht sich die Politik wiederum zunutze, um die Medien an der Oberfläche mit den von ihnen verlangten Inszenierungen zu bedienen, aber im Hinterzimmer ihr eigenes Programm weiter zu verfolgen. Koppeln sich der politische Prozess und der mediale Diskurs weiter voneinander ab, ist das gefährlich. Der Fall Thilo Sarrazin hat dies gezeigt. Die Politik war fast einhellig dazu entschlossen, die Thesen Sarrazins ohne weitere Debatte abzulehnen, während die Medien diese zur Diskussion stellten.
Auf Dauer kann dieses Auseinanderklaffen nur schädliche Folgen haben. Entweder kommt die Politik den Medien und ihren Ansprüchen noch weiter entgegen. Dann leistet sie einem weiteren Fortschreiten der Telepolitik Vorschub – das wäre die Variante Berlusconi. Oder die Politik verweigert sich. Sie könnte so ungestört weiter ihrem eigenen Programm folgen, doch die Folge wäre eine weitere Entpolitisierung der Medienlandschaft, wie sie etwa in Frankreich gerade zu beobachten ist. Gefragt sind also die Dritten im Bunde: die Bürger. Wenn diese ihre berechtigten Informationsansprüche offensiv einklagen, können sich auch Politik und Medien dem nicht dauerhaft entziehen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Wie die Botschaft ankommt – Politik und Sprache. Das Heft können Sie hier bestellen.