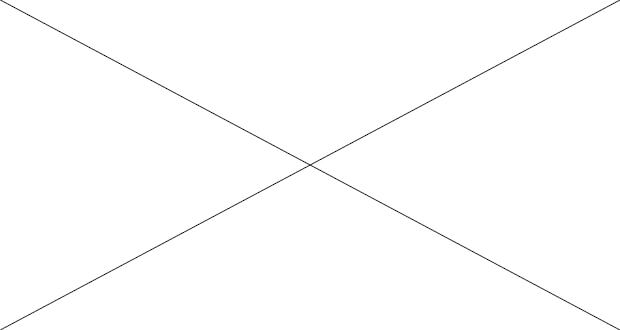It’s on!“ – dieser Ausruf eines Delegierten nach der mit Spannung erwarteten Rede von Sarah Palin auf dem Parteitag der Republikaner gibt wieder, was viele Anhänger der Republikaner fühlen: Jetzt geht’s los! Die Gouverneurin von Alaska hat soeben ihre Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidatin angenommen und eine beeindruckende Rede gehalten. Der Wahlkampf ist in die Zielgerade eingebogen.Der Kontrast zwischen den Kandidaten könnte stärker kaum sein: Hier der politische Newcomer Barack Obama, da die politische „Old Hand“ John McCain. Hier Washington-Insider und außenpolitisches Schwergewicht Joe Biden, da Sarah Palin, frische und außenpolitisch unbeschwerte Mutter von fünf Kindern. Ein Wahlkampf, der mitten in der Wirtschaftskrise geführt wird, in einer Zeit, in der sich die Amerikaner ihrer Zukunft nicht mehr sicher und ihrer außenpolitischen Stellung längst nicht mehr gewiss sind. Den Republikanern, ihnen voran Präsident George W. Bush, bläst dabei der Wind kräftig ins Gesicht. Bush hat die niedrigsten Zustimmungswerte, und das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit seiner Partei ist seit Monaten schlecht. Eigentlich spielt die Situation den Demokraten in die Hände. Dennoch liegen die beiden Kandidaten Kopf an Kopf, sammeln Geld in beispielloser Menge und motivieren Rekordzahlen von Freiwilligen, sich für die Kampagnen zu engagieren. Bereits der Präsidentschaftswahlkampf 2004 hat bewiesen, dass die neuen Finanzierungsregeln in den USA die Spender nicht daran hindern, Unsummen in den politischen Prozess zu pumpen. Der Wahlkampf 2008 bricht jedoch schon jetzt Rekorde: Bereits im Juli wurde die Spendengrenze von einer Milliarde Dollar durchbrochen.
Nach den Erfolgen im Vorwahlkampf kündigte der Demokrat Obama im Juni an, auf die staatliche Finanzierung zu verzichten. Als erster Kandidat entsagte er damit der finanziellen Waffengleichheit und ist nun bis zum Wahltag an keinerlei Spendenobergrenze gebunden. Bis Ende Juli sammelte er 400 Millionen Dollar. Dagegen nehmen sich die 170 Millionen des republikanischen Kontrahenten McCain fast besorgniserregend gering aus – gilt doch gerade im Präsidentschaftswahlkampf: Geld ist die Muttermilch der Politik.
Vielfältige Arsenale
Das Internet setzt seinen Siegeszug als kommunikatives Leitmedium für Politik fort. Über ein Viertel der Wähler bezeichnet mittlerweile das virtuelle Netz als primäre Quelle, sich über den Wahlkampf zu informieren. So verwundert nicht, dass sich die Kampagnenmacher immer neue Formen einfallen lassen, um die Nutzer online anzusprechen, einzubinden und zu aktivieren. Online-Werbung, -Spiele, -Videos: Das Arsenal ist vielfältig, die Ziele simpel. Entweder wollen die Kampagnen Geld oder sie wollen, dass der Nutzer ihnen so viel Zeit wie möglich widmet, um für die Kampagne aktiv zu werden. Die einfachen, virtuellen „Action Center“ des Wahlkampfs 2004 sind zu „Social Networks“ geworden, die mit den zentralen Datenbanken der Parteien verknüpft sind.
Der Nutzer wird zum Botschafter der Kampagnen umfunktioniert und mit den notwendigen Materialien, Tools und Botschaften ausgestattet, um losgelöst von den Kampagnenzentralen nach der eigenen Verfügbarkeit tätig zu werden. Wesentlich ist dabei der Gedanke der offenen Vernetzung. Die Aktivitäten sind für alle einsehbar und wirken so im psychologischen Sinne als Anreizsystem, mehr für die Kampagne zu tun. Wenn auch die technischen Neuerungen nur graduell weiterentwickelt wurden, so liegt die tatsächliche Innovation im Mentalitätswandel der Kampagnen.
Auch wenn die Zahlen von Onlinespenden und Freiwilligen bei den Demokraten um vieles höher sind, darf man die Republikaner nicht abschreiben, denn die Wahlen werden trotzdem nicht allein im Internet, sondern auch in Kirchen und Gemeindehäusern entschieden. Die Republikaner verfügen nach wie vor über die bessere Datenbank, um ihre Unterstützer zu erreichen. Eingesetzt wird dabei vor allem die klassische Direct-Mail – das Internet der Grand Old Party.
Wechselwähler sind Trumpf
In der geografischen Logik amerikanischer Präsidentschaftswahlkämpfe fungieren die Bundesstaaten quasi als Wahlkreise, die entsprechend ihrer Bevölkerungszahl unterschiedlich viele Wahlmänner für einen der Kandidaten in das „Electoral College“ entsenden.
Um Präsident zu werden, muss ein Kandidat mindestens 270 Wahlmännerstimmen auf sich vereinen. Die Ressourcen der Parteien werden im Wahlkampf strategisch nur in den Staaten eingesetzt, wo die Gewinnmarge eng und das Erringen der Wahlmännerstimmen möglich erscheinen. Die schnell wachsenden Staaten im Westen und im Süden sowie der Mittlere Westen mit seinen wechselbereiten Bundesstaaten spielen eine entscheidende Rolle. Die sich neu ergebenden Optionen, beispielsweise Virginia für Obama und Pennsylvania für McCain, führen nicht nur zu neuen geografischen Strategien, sondern verlangen auch das Anpassen der Botschaften an neue, sich mischende Wählerstrukturen. Waren die Wahlen 2004 gekennzeichnet durch eine hohe Polarisierung – vor allem mit der Ansprache und Mobilisierung der eigenen Basis, so ist 2008 der Wechselwähler wieder Trumpf. Viele Bush-Wähler aus dem Jahr 2004 sind verunsichert und unentschieden. Deswegen ist es kaum überraschend, dass beide Kampagnen darum konkurrieren, wer der bessere „Change Agent“ ist.
Während Bush eine intakte Wahlmaschinerie hinterlässt, machen es seine Zustimmungswerte und geringe Beliebtheit schwer für John McCain. Lange focht er den schwierigen Kampf, bei schlechter Stimmungslage das schwere außenpolitische Erbe von Bush zu verteidigen, um sich innerhalb der eigenen Partei gegen die Herausforderer durchzusetzen. So verwunderte es nicht, dass die Demokraten auf ihrem Parteitag eine Menge Zeit aufwendeten, John McCain zu einer Neuauflage von George W. Bush zu stempeln.
Dabei schien gerade die Wandel-Botschaft Barack Obamas als Kontrast gut zu verfangen – zwischenzeitlich lag er mit acht Punkten vor seinem Gegenkandidaten. Gerade in dieser Situation gelang es den Republikanern, ein lehrbuchhaftes Beispiel von Agenda-Setting zu zeigen, das sie zurück ins Spiel brachte: Einen Tag nach dem Parteitag der Demokraten gab McCain mit einem Überraschungscoup die Nominierung von Sarah Palin bekannt. Er schnitt dadurch nicht nur die Berichterstattung über den demokratischen Parteitag ab, sondern setzte auch ein Signal an zwei wesentliche Wählergruppen, auf deren mühsame Gewinnung er bisher abzielte: Frauen und die konservative Basis.
Zudem unterstrich er mit der Wahl seiner Vizepräsidentschaftskandidatin, selbst auf Wandel zu setzen. Als Reformerin hatte sich Palin in Alaska einen Namen gemacht. Dazu ist sie eine glaubwürdige Expertin in Energiefragen. Aber mehr noch: Zur Enttäuschung Obamas propagiert auch McCain seit dem Parteitag den Wechsel. Aufbauend auf sein Image als Außenseiter, als „Maverick“ nimmt er sich der Rhetorik des Demokraten an und greift ohne Scheu Wirtschaftsbosse, die verfehlte Irakpolitik Bushs oder korrupte Parteikollegen an. Strategie und Botschaft liefen synchron. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten beim Parteitag durch den Hurrikan Gustav ist das Rennen jetzt mehr als offen.
Gekonnte strategische Planung
Was können wir vom amerikanischen Wahlkampf lernen? Im Jahr 2008 gibt es deutlich weniger technische Neuerungen oder taktische Innovationen als 2004. Dennoch erweist sich der Wahlkampf bereits jetzt als lehrreich für europäische Augen. Das hohe Maß an strategischer Planung, die kommunikative Vorbereitung und die Event-bezogene Steuerung der Kampagnenführung unter Beibehaltung der Wechselwähleransprache sind beispielgebend. Auch in Deutschland streitet man um die Mitte. Es bleibt abzuwarten, wie genau die deutschen Experten bei der Strategie- und Botschaftsformulierung den amerikanischen Wahlkämpfern über die Schulter geschaut haben.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe 27 – Sonntag. Das Heft können Sie hier bestellen.