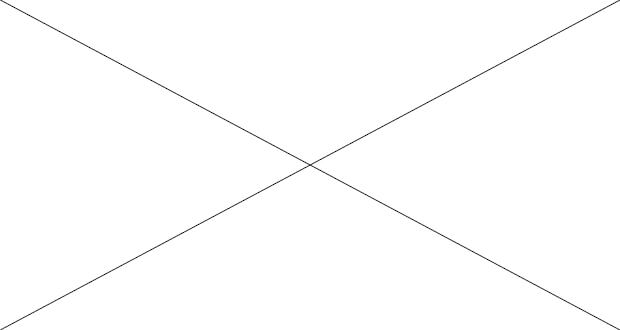Was war bloß mit Barack Obama und den Medien-Gurus im Weißen Haus los? Allseits bewundert für seinen modernen, professionellen und zugleich individuell zugeschnittenen Kommunikationsstil, der im Web 2.0 ebenso wirkte wie in Townhall-Meetings, reagierte der Präsident auf eine der größten Katastrophen der jüngeren amerikanischen Geschichte zu spät, zu kühl und ohne Strategie. Seine Regierung nahm das Unglück zwar von Anfang an wahr, kochte das Thema doch zunächst auf Sparflamme. Es dauerte ganze neun Tage, bis das Heimatschutz-Ministerium die Krise und deren Lösung zu einer „nationalen Angelegenheit“ ausrief. Und Obama selbst scherzte am selben Tag noch in einer Rede, er baue auf Lösungsvorschläge des wissenschaftlichen Nachwuchses. Instinkt und Führungsstärke sehen anders aus.
Die späte öffentlich sichtbare Reaktion war ein Fehler, der schwer wieder gut zu machen war. Denn nachdem Obama mit Verzögerung auf die Krise reagiert hatte, wartete er zu lange, ohne eigene Botschaften zu formulieren und zu transportieren. Kontrolle über die Situation hatten zunächst das gegnerische politische Lager und der Ölkonzern BP. Die Republikaner betitelten die Ölkrise schnell als „Obamas Katrina“. Die Anspielung auf Präsident George W. Bushs desaströse Reaktion auf den Hurrikan vor fünf Jahren war ein idealer Aufhänger, um Obama und die Demokraten so kurz vor den Kongresswahlen im November in Erklärungsnot zu bringen.
Ein Grund für Obamas Fehlstart mag in der Personalbesetzung des Krisenteams zu finden sein. Konteradmiralin Mary Landry, die den Einsatz am Golf von Mexiko koordinierte, leistete sich schwerwiegende Fehleinschätzungen. Zu Beginn schloss sie sich den Aussagen von BP an, wonach das Öl ausschließlich aus der gesunkenen Bohrinsel austrete. Später behauptete sie, den Einsatzkräften bliebe noch viel Zeit für die Bekämpfung des Ölteppichs. Zwei gravierende Fehler, die die Kompetenz des Krisenteams in Frage stellten. Am 1. Juni übernahm Konteradmiral James A. Watson den Posten von Mary Landry.
Kein „Chef der Emotionen“
Nicht nur das Krisenteam, sondern auch Obama selbst stand in der Kritik. So warfen ihm Medien und Bevölkerung vor, emotionslos und distanziert auf die Krise zu reagieren. Die „New York Times“ alleine veröffentlichte seit dem Unglück mehr als 600 Artikel zu der Ölkrise – viele davon werfen nicht das beste Licht auf den Präsidenten. „Noch einmal, mit Gefühl“ forderte etwa die einflussreiche Kolumnistin Maureen Dowd. „Die Bevölkerung erwartet von einem US-Präsidenten nicht nur Regierungschef, sondern auch Chef der Emotionen zu sein“, sagt der US-amerikanische Berater für Krisenkommunikation Peter Sandman. Andreas Schwarz, Geschäftsführer der International Research Group on Crisis Communication, stimmt zu: „Während in Deutschland eine nüchterne und faktenorientierte Krisenkommunikation stärker akzeptiert ist, zählt es in den USA, emotional den richtigen Ton zu treffen.“ Obama hätte sich also viel früher mit Betroffenen in der Küstenregion treffen müssen, um seine Glaubwürdigkeit mit Bildern zu untermauern.
Eine Veränderung in Obamas Kommunikationsstrategie war gut einen Monat nach der Katastrophe bemerkbar. Mit einer gezielten Offensive schien der Krisenstab alles daran zu setzen, endlich Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Vor allem galt es, BP zur Verantwortung zu ziehen. Obama kritisierte den Ölkonzern vermehrt und forderte ihn auf, für den finanziellen Schaden aufzukommen. Doch Obama ging ein Stück zu weit. Mehrfach nannte er den Ölkonzern bei dessen früheren Namen „British Petroleum“ und riskierte eine diplomatische Krise mit Großbritannien. In einem Telefonat mit Premierminister David Cameron beteuerte Obama kurz darauf, aus Ärger über die Situation überreagiert zu haben.
Neben gezielter BP-Schelte setzte der Präsident in der zweiten Phase seiner Strategie aber auch darauf, seine Emotionslosigkeit abzuschütteln. Auf seinen Reisen nach Louisiana traf er sich mit Betroffenen, verkostete bewusst die lokalen Spezialitäten und verkündete: „Ihr seid nicht alleine.“ Seine Wortwahl wurde zunehmend aggressiver. So wurde aus dem „Vorfall“ schnell ein „Desaster“ und schließlich ein „Anschlag auf die Küsten, Bewohner und die regionale Wirtschaft“. Am 15. Juni zündete Obama dann die nächste Rhetorik-Stufe und hielt, ganz Staatsmann, seine erste Rede an die Nation aus dem Oval Office.
Doch so ganz wollte es dem Staatsoberhaupt nicht gelingen, die Kritik an seiner Führungs- und Durchsetzungsstärke zu mildern. Die Ansprache kam für viele zu spät. „Obama hätte sich viel früher und vor allem häufiger an die Nation wenden müssen“, sagt Sandmann. Dazu kam, dass auch diese Ansprache sowohl von Demokraten als auch von Republikanern als glanzlos und langweilig abgetan wurde. „Es hat eine allgemeine Müdigkeit von Obama-Reden eingesetzt“, sagt Stephan Bachenheimer, Korrespondent der Deutschen Welle in Washington. „Jeder kennt inzwischen seinen Stil. Das ist ein typischer Abnutzeffekt, den alle US-Präsidenten durchlaufen.“
Schlechte Umfragewerte
Zu allem Überfluss scheiterte Obama auch noch auf der politischen Ebene. Sein generelles Verbot von Tiefseebohrungen wurde von einem Bundesgericht am 22. Juni wieder aufgehoben. Gab es doch andere Ölkonzerne, die ihre Lobbyarbeit in den USA verstärkten und heftig gegen das Verbot protestierten. Und auch das republikanische Lager mobilisierte gegen das Moratorium.
Zwar ist das BP-Leck inzwischen erfolgreich gestopft, doch Obamas Umfragewerte sanken auf den niedrigsten Wert seit seinem Amtsantritt im Januar 2009. Laut einer Umfrage von „USA Today“ und Gallup in der letzten Juli-Woche sind 53 Prozent der amerikanischen Bevölkerung mit Obamas Arbeit als Regierungschef unzufrieden. Die mäßige Krisenkommunikation während der Ölkrise ist aber nur ein Faktor von vielen, die Obama zu schaffen machen. Die negativen Umfragewerte reflektieren auch den Unmut der Amerikaner über das Hick-Hack um die Gesundheitsreform oder die jüngsten Finanzreformen, die von Teilen der Wirtschaft stark kritisiert werden. Hinzu kommen der immer mehr Opfer fordernde Krieg in Afghanistan und schließlich das politische Dauerfeuer der politischen Rechten und ihrer Medien, die in Obama ein neues Feindbild gefunden haben.
Wie gravierend der Schaden für Obama tatsächlich ist, werden die Kongresswahlen im November zeigen. Doch die nächste Krise kommt bestimmt, und dann sollte das Weiße Haus aus den Kommunikationspannen gelernt haben. Dabei gelten für Regierungschefs die gleichen Empfehlungen wie für CEOs, wenn es brenzlig wird: Durch frühes Reagieren Führungskraft beweisen; das Problem zur „Chefsache“ machen und Lösungsansätze präsentieren; vor Ort auf die Sorgen der Bürger eingehen; nicht nur für die Kameras handeln; Schadensbegrenzung oder Ausgleichszahlungen großzügig regeln.
Am wichtigsten sind aber Authentizität und Empathie in der Krisenbewältigung – dann entstehen auch starke Bilder, die sich einprägen. Erinnert sei an Matthias Platzeck, der als Brandenburgischer Umweltminister während des Oderhochwassers 1997 zum „Deichgrafen“ geadelt wurde oder an Helmut Schmidt, der als Hamburger Innensenator in der Sturmflut von 1962 zum Helden wurde. Ein Blick in die Geschichtsbücher kann für die strategische Kommunikation sehr nützlich sein.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Raus aus der Mühle – Warum Politiker zurücktreten. Das Heft können Sie hier bestellen.