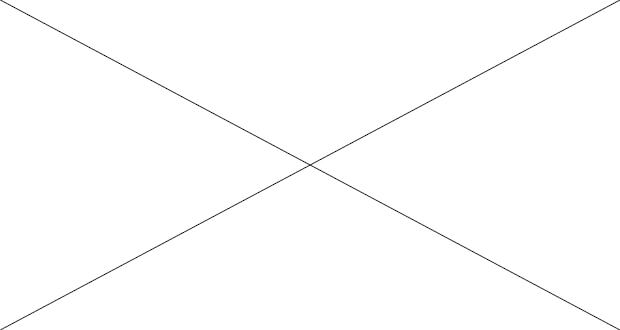Beeindruckend? Ja. Übertragbar? Nein. So einfach ließen sich die Ereignisse des Nominierungsparteitags der Demokraten in Denver zusammenfassen. Auf den zweiten Blick steckte jedoch auch für europäische Augen viel mehr hinter dem Parteitag als eine perfekt inszenierte Show. Denver hat gezeigt: Es gibt das andere Amerika, und es hat in Barack Obama jemanden gefunden, der dies brillant in Worte zu fassen weiß.
Es ist dieses Schwanken zwischen mitreißend und befremdlich, das einen unweigerlich im Pepsi-Center und dann am Schluss im Stadion – mitten unter 80.000 begeisterten Menschen – erfasste. Antragsberge, langwierige Geschäftsordungsdebatten oder spannende Kampfabstimmungen? Dieses Bild deutscher Parteitage gab es nicht in der blaugehaltenen und mit Lichteffekten versehenen Halle. Keine Berge von Unterlagen, die sich vor den Delegierten aufhäuften, kein Blatt Papier, das am Ende zu entsorgen war. Selbst die Rednerinnen und Redner erschienen ohne Manuskript. Ihre Reden, die zuvor Wort für Wort die Sichtung der Kampagnenleitung überstehen mussten, lasen sie fast unmerklich vom Teleprompter ab.
Politik neu definiert
Dieser Parteitag sollte nichts entscheiden, er sollte den Kandidaten präsentieren, Bedenken ausräumen und klare Signale in die Wohnzimmer tragen. Es war die Botschaft, die schon in Berlin 200.000 Menschen an die Siegessäule gelockt hatte: „Change“. Jeder einzelne Tag hatte seine feste Dramaturgie, die sich darunter einzuordnen hatte. Jede Botschaft des Tages wurde durch vorab an die Delegierten verteilte Plakate mediengerecht vorbereitet. Als die mit Spannung erwartete Hillary Clinton zur Geschlossenheit nach einem langen Nominierungsmarathon aufrief, schnellten diese also mit der Aufschrift „Unity“ nach oben. Von jetzt an hatten die Demokraten nur noch einen Wettbewerber: John McCain, dessen politische Angebote sie mit „more of the same“ gebetsmühlenartig auf den Punkt brachten.
Denver erfordert schon jetzt eine Neudefinition der US-amerikanischen Politik. Erstmals gibt es in den USA einen farbigen Präsidentschaftskandidaten, gerade weil er nicht als solcher angetreten ist. Obama steht für den „American Dream“ im besten Sinne. Sein Erfolg begründet sich im Appell auf Reformfähigkeit durch gemeinsames Handeln, hinweg über alte Gräben. Auch für das transatlantische Verhältnis verspricht Denver einen neuen Abschnitt der Kooperation jenseits der ungleichen Grillfreundschaft von Bush und Merkel.
Mehr als nur Show
Doch dem „Yes, we can!“ wird die Mühsal der Umsetzung folgen müssen. So steht zum Beispiel Obamas Ziel der Unabhängigkeit von Öllieferungen aus dem Nahen Osten innerhalb von nur zehn Jahren ein Straßenbild gegenüber, das weiterhin von riesigen Spritschleudern geprägt ist. Dies markiert die ungeheure Herausforderung, aber auch, was aus deutscher Sicht von der laufenden Obama-Kampagne zu lernen ist: Mut zur grundsätzlichen Strukturfrage. Gestaltungsanspruch muss sich mit dem Willen verbinden, die notwendigen Fragen anzupacken. Wer sich für eine Idee begeistern kann, kann andere begeistern. Visionen können Mehrheiten gewinnen und die Lobbyinteressen des Stillstands überwinden, wenn sie die Probleme der Menschen aufgreifen und Perspektiven bieten.
Undenkbar, dass es einen solchen Parteitag in Europa oder Deutschland geben kann. Der deutschen Politik stünde es jedoch gut an, genau diese Grundzüge des Erfolgs zu studieren. Und der demokratische Parteitag erfordert noch mehr: Denver unter dem Stichwort „Show statt Politik“ abzutun, wäre fahrlässig. Sollte Obama seine Pläne angehen können, wird auch in Deutschland mancher Plan der großen Geste als kleinlich erscheinen. Was wir brauchen, ist mehr Mut für größere Ziele. Dass sich damit Unterstützung mobilisieren lässt, war der kopierbare Bestandteil des Nominierungsparteitags.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe 27 – Sonntag. Das Heft können Sie hier bestellen.