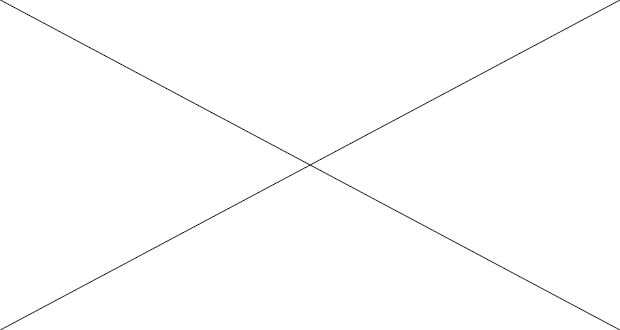Als die chinesische Führung Anfang April 16 Webseiten sperrte, um der weiteren Verbreitung von „Internetgerüchten und Lügen“ entgegen zu wirken, wurde wieder einmal deutlich, wie Regierungskommunikation innerhalb Chinas funktioniert – oder eben auch nicht. Diese „notwendige Säuberungsaktion“ (so das Parteiorgan „Volkszeitung“) folgte, nachdem Ende März im Internet tagelang Gerüchte die Runde machten, wonach es in Peking im Zuge interner Parteimachtkämpfe zu einem Putsch gekommen sein sollte. Die Mutmaßungen waren auch deshalb so wild, weil die alleinherrschende Kommunistische Partei ihre Untertanen traditionell darüber im Unklaren lässt, was ihre Führer so treiben. Diese Intransparenz, auch und gerade in Personalfragen, führt nach wie vor dazu, dass Chinesen den Status innerhalb der Führungsmannschaft daran ablesen, wer in den Fernsehnachrichten auftaucht und wer nicht.
Während Peking daheim mit den altbewährten Kommunikationsmitteln kommunistischer Prägung agiert, also einerseits Schweigen und andererseits Zensur und Gängelung der Medien, zeigt sich die Volksrepublik auf internationaler Bühne erstaunlich kreativ, wenn es darum geht, mit der Weltöffentlichkeit zu kommunizieren, um das Image des Landes zu verbessern. Für seine Public Diplomacy, also die Kommunikation mit der Bevölkerung anderer Länder, nutzt Peking prinzipiell die gleichen Instrumente wie andere Regierungen, also die klassischen Medien und das Internet, Kulturveranstaltungen, Austauschprogramme oder Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele 2008 in Peking oder die Weltausstellung 2010 in Shanghai.
Geballte Medienmacht
Seit dem Jahr 2009 hat die chinesische Regierung rund 8,7 Milliarden US-Dollar in die vier großen staatlichen Medienbetriebe investiert: die Nachrichtenagentur Xinhua, den Fernsehsender CCTV, den Radiosender CRI und die englischsprachige Tageszeitung „China Daily“. Die Zeitung hat seit 2009 eine eigene US-Ausgabe und veröffentlicht seit Dezember 2010 eine europäische Wochenausgabe. Im Juli 2009 startete CCTV sein arabisch-sprachiges Programm und sendet nun in fünf Fremdsprachen (auch in Englisch, Russisch, Spanisch und Französisch). CRI berichtet sogar in 43 Fremdsprachen und Dialekten. Die Agentur Xinhua hat weltweit rund 400 Korrespondenten in 117 Büros, bis 2020 sollen es bis zu 180 Außenposten werden. Außerdem verfügt sie seit Sommer 2010 über einen eigenen englischsprachigen Fernsehsender.
Mit ihren Angeboten bedient die Agentur, die direkt dem Propagandaministerium untersteht, weltweit rund 80.000 Kunden. Erfolgreich ist Xinhua insbesondere in Entwicklungsländern, da die Agentur ihre Dienste wesentlich günstiger anbietet als die westliche Konkurrenz. Und können Kunden gar nicht bezahlen, dann liefert Xinhua Inhalte, Ausrüstung und technische Unterstützung auch gratis. Allerdings steht diese Medienoffensive vor allem im Westen im Verdacht, bloßes Propagandainstrument der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zu sein.
Während die chinesischen Medien als Public-Diplomacy-Instrumente nicht auf der ganzen Welt überzeugen können, sind zwei andere Instrumente der chinesischen Charme Offensive erfolgreicher: Das prominenteste Instrument sind die 360 Konfuzius-Institute und die 500 „Konfuzius-Klassenzimmer“ an Schulen, die der interessierten Öffentlichkeit in aller Welt die chinesische Sprache und Kultur vermitteln sollen. Ende 2011 zählten die Institute weltweit rund eine halbe Million Kursteilnehmer, laut offiziellen Angaben fanden 10.000 Kulturveranstaltungen mit 7,2 Millionen Besuchern statt.
Das Besondere an den Instituten ist ihre Struktur als Joint Ventures zwischen chinesischen und internationalen Partnern. Dabei stellt die internationale Seite Räumlichkeiten und örtliche Mitarbeiter, China schickt Sprachlehrer, meist einen Vize-Direktor, Lehrmaterialen und zahlt einen Teil des Budgets. So erhalten die Institute jährlich durchschnittlich 100.000 US-Dollar, außerdem können sie zusätzliche Projektgelder beantragen. Allerdings müssen die internationalen Partner auch investieren: zunächst in die Räumlichkeiten und lokalen Kräfte, und auch bei den Projektmitteln werden die Kosten zwischen chinesischen und internationalen Partnern geteilt.
Noch eklatanter ist die internationale finanzielle Beteiligung an Chinas Public Diplomacy bei Chinas so genannter Panda-Diplomatie. Während Riesenpandas, die es nur in China gibt, bis Mitte der 1980er Jahre an wichtige oder wohlgesinnte Länder verschenkt wurden, werden sie heute unter strengen Auflagen im Rahmen von wissenschaftlichen Kooperationen an zahlungskräftige Zoos ausgeliehen. Rund eine Million Dollar pro Jahr muss ein Zoo für ein Pandapaar zahlen, das für zehn Jahre ausgeliehen wird. Dazu kommen für viele Zoos Umbaukosten in Millionenhöhe, und allein die Verpflegung der Tiere mit Bambus schlägt pro Jahr mit rund 150.000 Euro zu Buche.
Offiziell geht es zwar um tiermedizinische Kooperationen und die Erhaltung der vom Aussterben bedrohten Art durch Nachwuchsgewinnung, aber die enorm positive Image-Wirkung ist dabei durchaus einkalkuliert. 2009 bekam der Zoo im australischen Adelaide zwei Pandas und verzeichnete im ersten Jahr einen Besucherzuwachs von 70 Prozent. Der Edinburgher Zoo vermeldete im Dezember 2011, dem ersten Monat mit Pandas, gar einen Besucheranstieg von 200 Prozent. Doch auch wenn die Pandas Besuchermagneten sind, können sie die teilweise enormen Kosten für die Zoos nicht immer einspielen. So leidet der Zoo in Adelaide an einer Schuldenlast von 24 Millionen Australischen Dollar, was auf die Beherbergung der Bären zurückzuführen ist.
Aus chinesischer Sicht allerdings sind die Pandas ein absoluter Erfolg. Die Besucher im Ausland sind begeistert, beschäftigen sich nicht mit so lästigen Themen wie Menschenrechten oder dem Dalai Lama, und selbst die sonst so chinakritischen Medien geraten bei den Bären mehrheitlich in Verzückung. Die Panda-Diplomatie mag auf den ersten Blick skurril erscheinen – sie ist Teil einer Strategie. So konnte zum Beispiel der kanadische Premier Stephen Harper diesen Februar auf einer China-Reise verkünden, dass Kanada 2013 zwei Pandas bekommen wird. Harper wurde mit den Pandas nicht nur dafür belohnt, dass er sich vom China-Kritiker zu Beginn seiner Amtszeit zum China-Freund gemausert hat, sondern wohl auch, weil sich China in Kanada enorme Rohstoffvorkommen sichern konnte, die für die Entwicklung des Landes immens wichtig sind.
Die Kritik bleibt
Insgesamt zeigen Konfuzius-Institute und Panda-Diplomatie eines ganz deutlich: China nutzt die durchaus bestehende globale Faszination der chinesischen Kultur überaus geschickt, indem es sich internationale Partner ins Boot holt und so von deren Expertise, Infrastruktur und Prestige profitiert. Noch entscheidender aus chinesischer Sicht ist allerdings, dass es im Ausland zahlreiche Partner gibt, die bereit sind, Chinas Public Diplomacy mitzufinanzieren und sich dafür im Heimatland, siehe Konfuzius-Institute, mitunter heftiger Kritik ausgesetzt sehen. Allerdings können noch so süße Pandas und noch so viele Konfuzius-Institute nicht wettmachen, was die Regierung zu Hause beschädigt. Denn jede noch so kreative Außendarstellung bleibt erfolglos, wenn in China nach wie vor Internetseiten gesperrt, Medien zensiert oder Dissidenten verhaftet werden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Alles Fake – Wenn Bürgerdialog nur PR ist. Das Heft können Sie hier bestellen.