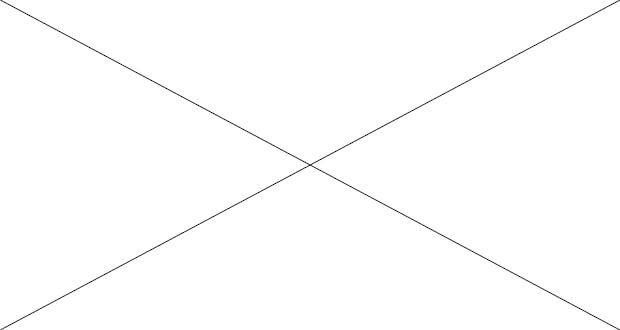Saunabesuche, Waldspaziergänge, gemütliches Beisammensitzen bei Kaffee, Bier oder Wodka. Immer wieder zeigen sich Spitzenpolitiker von ihrer menschlichen Seite und verkünden, auch ausländische Kollegen zu ihrem privaten Freundeskreis zu zählen.
Was aber ist wirklich dran, wenn Boris Jelzin und Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Wladimir Putin oder Angela Merkel und George W. Bush gemeinsam Freizeit verbringen, wie andere Menschen mit ihren besten Freunden? Schwer zu unterscheiden, was echt ist und was nur Fassade. „Jeder Spitzenpolitiker nennt den anderen erstmal seinen Freund“, meint „Zeit“-Autor Gunter Hofmann. Eine „pauschale Formel“, um die persönlichen Beziehungen zwischen Präsidenten und Kanzlern verschiedener Länder zu beurteilen, gebe es nicht. Sicher ist nur, dass nicht jede Freundschaft, die so genannt wird, auch wirklich eine ist. Mainhardt Graf von Nayhauß, der seit sechs Jahrzehnten als Hauptkorrespondent – unter anderem bei „Spiegel“, „Stern“ und derzeit bei „Bild“ – über die mächtigsten Politiker in Deutschland schreibt, betrachtet die Kumpeleien der Mächtigen nüchtern, „Zweckfreundschaften“ nennt er sie.
Nayhauß‘ Diagnose rückt eine Frage in den Vordergrund: Warum einen fremden Menschen Freund nennen? Die Gründe sind vielfältig. Einer davon ist in der Freund-Feind-Unterscheidung des Staatsrechtlers Carl Schmitt begründet. Gerade im internationalen Rahmen wird der Begriff „Freundschaft“ oft verwendet. Jedoch als Metapher. „So vermeidet man den Eindruck, es gäbe Feindschaft“, sagt Vincenz Leuschner, Soziologe an der Humboldt-Universität in Berlin. Trotzdem könne auf dieser Basis wechselseitiges Vertrauen gedeihen und der politische Informationsfluss beschleunigt werden. Als Beispiel eines solchen Falls gilt die Beziehung zwischen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. „Deren Händchenhalten und Geküsse ist regelrecht grotesk“, sagt von Nayhauß. Und doch erfülle es einen wichtigen internationalen Zweck. Hofmann nennt die Beziehung eine „Vernunftkoalition“, weil die deutsch-französischen Beziehungen funktionieren müssten.
Freundschaften aufbauen
Dieses Zurschaustellen einer inszenierten Freundschaft mit Hilfe der Medien ist weder ungewöhnlich noch neu. Klaus Otto Skibowski, ehemaliger Berater und Biograf Konrad Adenauers, schaffte es seinerzeit, „menschliche Kontakte“ zwischen Adenauer und John F. Kennedy herzustellen. Größtes Hindernis dabei: der große Altersunterschied zwischen den beiden Staatsmännern. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Treffen lag für Skibowski bei Kennedys Kindern. Er wusste, dass Adenauer gut mit Kindern konnte, riet Kennedy, seinen Nachwuchs mitzubringen. So entstand persönliche Nähe, die auch für die deutsch-amerikanischen Beziehungen förderlich war. Auf ähnliche Art entwickelte sich die Beziehung zwischen Adenauer und Charles de Gaulle.
Der damalige französische Staatspräsident sei dem deutschen Bundeskanzler zunächst skeptisch begegnet, sagt Skibowski, jedoch musste wenigstens symbolisch gezeigt werden, dass Deutschland und Frankreich an einem Strang zögen. So wurde ein rein berufliches Pflichtverhältnis zur Freundschaft deklariert. Klar ist: Adenauers Beziehungen zum britischen Premier Winston Churchill und dessen Amtskollegen aus Israel, David Ben Gurion, waren bei weitem persönlicher. Bei politischen Freundschaften ist Skepsis also angebracht. Oft drehen sie sich mehr um Macht und Stellung eines Landes als um ehrliche, persönliche Sympathie. Nicht so Helmut Schmidt und Valéry Giscard d’Estaing.
Die Beziehung zwischen dem ehemaligen Bundeskanzler und dem früheren französischen Staatspräsidenten prägte großes Vertrauen. Davon zeugt unter anderem eine Anekdote in von Nayhauß’ Kanzlerbiografie „Helmut Schmidt – Mensch und Macher“ deutlich. Als Schmidt im Haus des französischen Präsidenten einen Schwächeanfall erlitt, wahrte Giscard d’Estaing höchste Diskretion. Auch habe er sich, weit über die üblichen förmlichen Verhaltensweisen hinaus, so lange rührend um „seinen Freund Helmut“ gekümmert, bis ein Arzt zur Stelle war. In diesem Fall ist klar: Es handelt sich um mehr als nur reine Inszenierung.
Sympathie verzerrt Realität
Wie aber kommt es dazu, dass Spitzenpolitiker sich über nationale Grenzen hinweg so nahe kommen? „Bei Schmidt und Giscard war es die sogenannte Währungsschlange“, sagt von Nayhauß. Beide wollten einen europäischen Wechselkursverbund verwirklichen, das habe die Politiker zusammengeschweißt – und das bereits 1972, also zwei Jahre bevor Schmidt Kanzler und Giscard d’Estaing Präsident wurden. Laut Leuschner ist dieser Zusammenhang keine Ausnahme. Häufig gingen „politische Prozesse, die Länder zusammenführen,“ den persönlichen Beziehungen voraus. Gerade in der Politik, wo Konkurrenz um Vormachtstellungen und Argwohn vor den Schritten des anderen allgegenwärtig seien, bedürfe es viel Zeit, um sich gegenseitig zu beschnuppern, so Leuschner. Für den Soziologen gilt die Faustformel: erst bilaterale Beziehungen, dann Vertrauen und Freundschaft.
Echte Freundschaft scheint es auch zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin zu geben. Gunter Hofmann glaubt, dass Schröder Putin bewundert. Es sei „eine Männerfreundschaft ohne Fassade“. Während der von Helmut Kohl und Franz Josef Strauß geprägte Begriff der Männerfreundschaft eine von Machtambitionen gekennzeichnete strategische Freundschaft beschreibe, handele es sich bei Schröder und Putin um persönliche Sympathie. Neben den üblichen Besuchen sei diese politische Beziehung von großem Vertrauen geprägt. Schröders Äußerung, Putin sei „ein lupenreiner Demokrat“, unterstreiche dies. Leuschner erkennt in Schröders Aussage, dass Sympathie mitunter „die Wahrnehmung verzerren“ kann. So wird deutlich, dass es auch unter Politikern eine Form der Zuneigung geben kann, die nicht auf beidseitige Vorteile beschränkt ist.
Dadurch unterscheiden sich echte von inszenierten politischen Freundschaften. Lädt der US-amerikanische Präsident George W. Bush Staatsgäste auf seine Ranch in Texas ein, erzeugt das zwar oberflächlich ein Gefühl von Vertrauen, es bleibt aber reine Symbolhandlung. Hat die Freundschaft auch in Zeiten politischer Krisen Bestand, kann von echter Freundschaft ausgegangen werden.
Somit bleibt Freundschaft in der Politik ein dehnbarer Begriff. Der Großteil der persönlichen Beziehungen erscheint als unterkühlt und austauschbar. Dennoch spielen gerade im internationalen Bereich Vertrauen und Sympathie eine wichtige Rolle. Bilaterale Beziehungen brauchen eine persönliche Ebene. Wenn diese nicht vorhanden ist, kann sie künstlich geschaffen werden – und wer weiß, vielleicht wird eine Freundschaft daraus.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe wir wollen rein – Bundestag 2009. Das Heft können Sie hier bestellen.