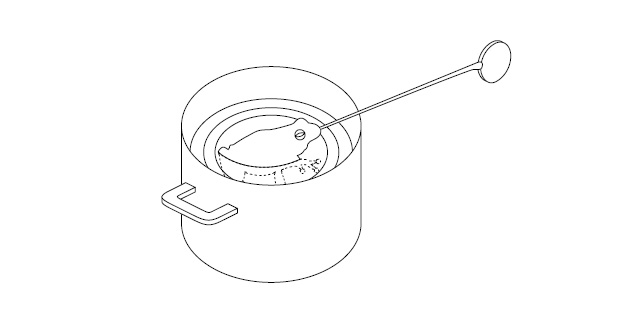Es ist ein grauenhafter Vorfall, den die “Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten” am 9. Oktober 1812 meldet: Der Lehrbub des Schlossers gewinnt 200 Taler in der Lotterie – doch damit ist sein Glück aufgebraucht. Was passiert, schildert die Zeitung so: “Der Knabe, voll von seinem Gluecke, eilt mit dem Gelde zuvor zu seinem Lehrherrn und erzaehlt ihm den ganzen Vorfall. Dieser, ein wohlhabender Mann, wird von dem Anblick des Geldes auf eine so unbegreifliche Weise gereizt, daß er dem Knaben seine theilnehmende Freude heuchelt, aber sogleich auf den Tod desselben denkt. Er schickt ihn nach Kohlen in den Keller, folgt ihm aber sogleich mit einem schweren Hammer nach und erschlaegt ihn.”
Geld ist der vielleicht härteste Prüfstein für menschliche Charaktere: Sein Anblick, ja alleine der Gedanke an Geld erweist sich für viele Menschen als Stolperstein. Die Geschichte des Lehrherrn, der beim Anblick von Geld durchdreht, ist kein Einzelfall. Literatur und Kriminalgeschichte bieten hinreichend Anschauungsunterricht dafür, was Ökonomen und Psychologen in zahlreichen Studien herausgefunden haben: Geld verändert unseren Charakter, unser Verhalten und unser Handeln.
Dem Zusammenhang zwischen Geld und Charakter kommt man mithilfe eines einfachen Versuchsdesigns auf die Spur: In einem ersten Schritt lässt man Probanden Sätze vervollständigen, die mit Geld oder aber etwas anderem zu tun haben (“Ich reichte einen Scheck ein” oder “Ich schrieb einen Brief”) oder zeigt ihnen Bilder von Geld. Hat man auf diesem Weg ihre Gedanken auf die Idee von Geld gelenkt, untersucht man ihr Verhalten in bestimmten Situationen und vergleicht es mit dem Verhalten von Versuchspersonen, deren Gedanken auf neutrale Dinge gerichtet wurden.
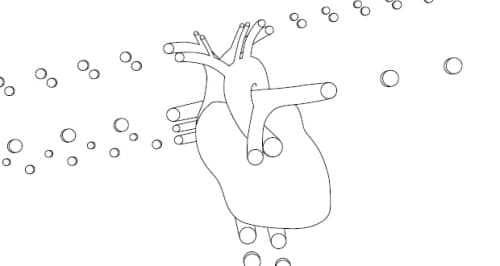
Illustration: Marcel Franke
Die Ergebnisse solcher Experimente belegen die Idee, dass Geld den Charakter verdirbt: Wer an Geld denkt, spendet weniger für gute Zwecke und ist weniger hilfsbereit als Menschen, die nicht über Geld nachdenken. Der Anblick von Geld versetzt Menschen in eine Art Geschäftsmodus, sie denken stärker in Kategorien wie Handel, Geschäft oder Gewinn und unternehmen erhöhte Anstrengungen, wenn es darum geht, Aufgaben zu erledigen. Der Gedanke an Geld erhöht auch unsere Bereitschaft, Ungleichheit zu akzeptieren: Wir teilen Schokolade mit unseren Mitmenschen eher zu gleichen Teilen als Geld. Geld fokussiert unser Denken eher auf Leistung und Anreize. Vermutlich bewirkt der Gedanke an Geld, dass wir in einen Marktmodus schalten – schließlich ist Geld das Zahlungsmittel, die Sprache der Marktwirtschaft. Und wer an Markt denkt, denkt an Leistung und ist bereit, sich mehr anzustrengen und möglicherweise weniger hilfsbereit.
Diese Leistungsgedanken machen uns wohl auch einsamer: Wer an Geld denkt, legt mehr Wert auf seine Eigenständigkeit, lässt sich weniger von anderen Meinungen beeinflussen. Man sucht mehr Distanz zu seinen Mitmenschen, und das ist wörtlich zu nehmen: Menschen, die einen Bildschirmschoner betrachten, auf dem Geldscheine zu sehen sind, suchen mehr Distanz zu den Menschen, die im gleichen Raum sitzen. Geld löst sogar unethisches Verhalten aus: Allein der Anblick eines Geldstapels führt dazu, dass Menschen bei Experimenten im Labor stärker dazu neigen zu mogeln. Wer ehrliche Mitarbeiter will, sollte keine Bilder von Geld im Büro aufhängen.
Und es kommt noch schlimmer: Geld kann sogar Schmerzen lindern. Wer zuvor Geld gezählt hat, empfindet weniger Schmerzen, wenn seine Hände in heißes Wasser getaucht werden. Wer nur Papierbögen zählt, hat mehr Schmerzen. Weitere Experimente zeigen, dass Geld das Gefühl von Verlassenheit bekämpfen kann, ja sogar dass der Gedanke an Geld die Angst vor dem Tod reduziert – Geld wirkt fast wie eine Droge.
Keine Frage, Geld macht den Unterschied – aber wieso? Forscher vermuten, dass Geld die universelle Chiffre für Reichtum, Wohlstand und Marktwirtschaft ist und dass der Gedanke an Geld in uns einen Geschäftsmodus bringt, in dem bestimmte Verhaltensweisen automatisch aktiviert werden. Andere Verhaltensweisen hingegen finden in diesem gedanklichen Universum weniger Platz, weil sie dort nicht hingehören – also zieht man dieses Verhalten gar nicht in Betracht. Das entspricht ein wenig dem Effekt, der sich beobachten lässt, wenn wir dem Bademeister zum ersten Mal auf der Straße voll bekleidet begegnen: Wir erkennen ihn nicht sofort, weil er sich nicht in dem Umfeld bewegt, aus dem wir ihn kennen.
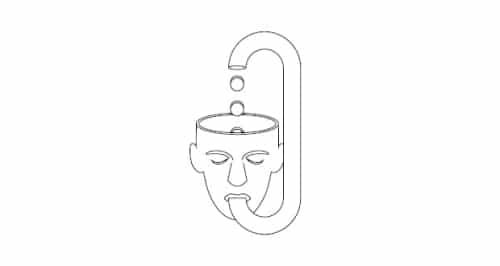
Illustration: Marcel Franke
Schräg ist das allemal – aber was bedeutet es? Ist Geld die Wurzel allen Übels? Macht es uns zu leistungsfixierten Egoisten? Ganz so voreilig sollte man nicht sein. Letztlich belegen diese Forschungen, dass Menschen in verschiedenen Denkmustern agieren und dass diese Denkmuster durch bestimmte Assoziationen aktiviert werden können. Das funktioniert nicht nur bei Geld: Wer beispielsweise mit dem Thema Altern konfrontiert wird, bewegt sich langsamer und wer einen Bleistift so zwischen die Zähne nimmt, dass ein Lächeln simuliert wird, findet die Comics, die er liest, lustiger. Es ist nicht das Geld, das uns egoistisch oder leistungsorientiert macht. Die Begegnung mit dem Geld ruft nur jenen Teil unseres Verhaltens wach, der Marktmechanismen kennt und befolgt.
Ist es schlecht, wenn der Gedanke an Geld unser marktwirtschaftliches Gedächtnis aktiviert? Das kommt auf die Sichtweise an: Wer mit Geld hantiert, gerade als Politiker mit großen Beträgen, braucht Sorgfalt und ökonomisches Denken, andernfalls drohen Geld- und Ressourcenverschwendung. Unterstellt man, dass marktwirtschaftliches Denken zu effizienten Ergebnissen führt, dann stellt die Aktivierung unseres marktwirtschaftlichen Denkens sicher, dass wir unser Geld effizient verwenden.
Die Kehrseite dieses Denkens ist die Solidarität: Marktwirtschaftliche Systeme sorgen für Leistungsgerechtigkeit, aber nicht für Verteilungsgerechtigkeit im Sinne einer Bedarfsgerechtigkeit. Vereinfacht gesagt sind die Grenzen der Solidarität im marktwirtschaftlichen Denken naturgemäß enger gesteckt als in anderen Denk- und Politiksystemen. So gesehen schwächt der Gedanke an Geld die Idee der politischen Solidarität. Politiker, die mit großen Geldbeträgen hantieren, haben möglicherweise einen Hang zu marktwirtschaftlichem Denken, aber weniger Blick für soziale Belange. Damit zeigt sich in unserem Denken und Handeln der elementare Konflikt allen wirtschaftlichen Handelns, der zwischen Effizienz und Bedarfsgerechtigkeit. Es ist auch ein politischer Konflikt. Lässt er sich auflösen?
In der Politik vermutlich ja. Der Effekt, dass Geld unser marktwirtschaftliches Gedankensystem aktiviert, dürfte bei Politikern von einem anderen Effekt überlagert werden, nämlich ihrer ideologischen Vorprägung. Konservative Parteien haben von Natur aus einen ideologischen Fokus auf Leistungsgerechtigkeit und marktwirtschaftliche Prozesse, linke Parteien hingegen betrachten in der Regel alle Themen zunächst durch die Brille der Verteilungsgerechtigkeit mit Fokus auf die Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Schwer zu sagen, welcher der beiden Effekte überwiegt, aber das Verhalten der Politiker lässt vermuten, dass die ideologische Vorprägung die Prägung durch den Geld-Gedanken schlägt.
Politische Reflexe schlagen hier vermutlich die geldbedingten, vor allem, weil man vermuten muss, dass eine Politik der Umverteilung zwecks Wählerstimmenmaximierung zu den politischen Urinstinkten gehört. Doch nicht nur das: Politiker geben anderer Leute Geld für andere Leute aus – die Anreize, effizient zu sein, sind damit recht gering, so dass dieser Umstand ebenfalls dazu beitragen dürfte, dass Politiker die Spendierhosen nicht unbedingt enger schnallen, nur weil sie an Geld denken.

Illustration: Marcel Franke
Was aber ist mit den Wählern und Medienkonsumenten? Was löst es bei ihnen aus, wenn in den Medien über die Kosten der Politik in Euro und Cent berichtet wird? Euro-Rettung, Finanzkrise, Bankenrettung, Rentenreform, Hartz-Reformen oder Kinderbetreuung – kein Thema, das in den Medien nicht in Euro übersetzt wird. Die Idee, dass der Gedanke an Geld unser Denken beeinflusst, legt nahe, dass die Art der Berichterstattung auch die Haltung der Wähler beeinflusst – verengt die Berichterstattung mit Fokus auf den Kostenfaktor unsere politische Wahrnehmung auf finanzielle Aspekte?
Ein Beispiel dafür könnte die Flüchtlingsdebatte sein: Wochenlang lieferten sich Journalisten eine Debatte darum, ob Einwanderer und Flüchtlinge die Bundesrepublik Geld kosten oder ihr sogar Geld einbringen – mit vorhersehbar unbestimmten Ergebnissen. Hätte man den Fokus nicht aufs Geld gerichtet, so hätte man dieser Debatte einen anderen Dreh geben können. Selbst wenn es uns Geld kostet, Flüchtlinge aufzunehmen, so können wir doch letztlich stolz darauf sein, dass wir willens und in der Lage sind, anderen Menschen zu helfen.
Ob der Geld-Modus, in den diese Debatte geschaltet war, diese Idee verhindert hat? Was macht Geld mit Journalisten und Wählern? Zum einen muss man vermuten, dass die ideologische Voreinstellung auch bei Wählern und Medienkonsumenten eine Rolle spielt, ebenso wie bei den Journalisten. Die Berichterstattung über Euro- und Cent-Themen ist nicht objektiv, sie kann es vermutlich auch gar nicht sein – warum sollten Journalisten gegen diese psychologischen Effekte immun sein?
In der reinen Theorie lässt sich dieses Dilemma leicht auflösen; rationale Wirtschaftspolitik müsste so aussehen: Zuerst sucht man nach einer effizienten Lösung, die Kosten minimiert und Erträge maximiert, anschließend überlegt und entscheidet man, wie man die derart maximierten Erträge fair und gerecht aufteilt – eine Gratwanderung zwischen Solidarität und den notwendigen Leistungsanreizen – dann handelt man. Stimmen aber die Ideen der Psychologen, dann fällt uns dieser politische Dreisprung deswegen so schwer, weil wir in unserem Denken und in unseren Entscheidungen vorgeprägt sind – so oder so.
Was aber kann man pragmatisch tun? Vielleicht hilft ja schon das Wissen um diese psychologischen Effekte, ihnen ein wenig aus dem Weg zu gehen. Wer als Politiker und Journalist den gedanklichen Dreisprung aus Effizienz, Verteilung und Entscheidung beherzigt oder wenigstens versucht, kommt zu strukturierteren und damit auch besseren Entscheidungen. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme hilft auch Wählern und Medienkonsumenten: Je mehr und je breiter man sich informiert, umso größer ist die Chance, dass man ein ausgewogenes Meinungsbild erhält. So betrachtet ist Information die erste Politiker-, Journalisten- und Bürgerpflicht.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation III/2015 Geld. Das Heft können Sie hier bestellen.