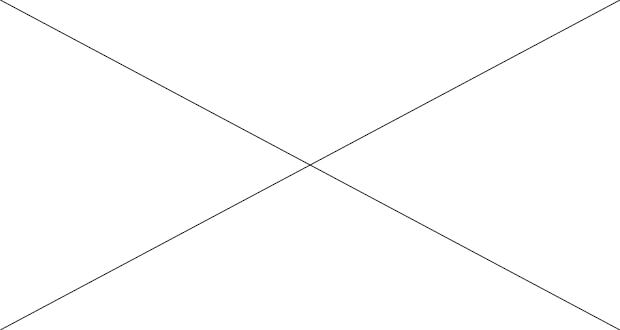p&k: Herr Wowereit, seit zehn Jahren sind Parlament und Regierung wieder in Berlin. Hat es Deutschland gut getan, dass es wieder eine Metropole als Hauptstadt hat?
Klaus Wowereit: Auf jeden Fall. Dass die Politik heute in einer Stadt gemacht wird, in der man das Zusammenwachsen hautnah erlebt, ist ein Gewinn. Im Berliner Alltag begegnen die Politiker und Beamten all den Veränderungen, Brüchen und Widersprüchen, die unsere Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts prägen. Viele empfinden das als enorm anregend. Denken Sie an die Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft oder an die demographischen Veränderungen. Berlin ist so etwas wie ein Seismograph für gesamtgesellschaftliche Trends, aber natürlich auch ein Labor für neue Lösungen.
Ist das mit der gewachsenen Nähe zum Alltag und zu den Bürgern nicht eine Illusion? Bundeskanzleramt und Reichstagsgebäude stehen in Berlin zwar an einem zentralen Ort, doch tummeln sich da vor allem Touristen. Wurde das Ziel einer größeren Nähe verfehlt?
Erstens sind viele Touristen auch Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Aber noch wichtiger ist: Politiker und Beamte, aber auch die vielen in Berlin tätigen Journalisten arbeiten nicht nur in der Stadt, sie leben mit ihren Familien auch in unterschiedlichen Kiezen. Sie schicken ihre Kinder auf Berliner Schulen und fahren mit der U-Bahn oder mit dem Taxi. Da ist man mitten im Alltag und kriegt eine Menge mit – von den Konflikten und Schwierigkeiten, aber auch von der faszinierenden Dynamik dieser Großstadt.
Angeblich hat sich die politische Kultur in Deutschland seit dem Umzug verändert. In Berlin gehe es schneller und oberflächlicher zu. Hat das auch damit zu tun, dass Bonn eine viel bürgerlichere Stadt ist als Berlin?
Es ist schwer, zwei Prozesse voneinander zu trennen: Zeitgleich mit dem Umzug von Parlament und Regierung fand auch der Siegeszug des Internets statt. Beides – der Umzug vom beschaulichen Bonn in eine Stadt des rasanten Wandels und die Veränderung der Medien – hat zweifellos zur Beschleunigung des Geschehens geführt. Und dann gibt es natürlich auch eine neue Politikergeneration, die weiß: Man kann in der Politik noch so hehre Ziele verfolgen; für den Erfolg genügt das nicht. Da gehört eben auch der professionelle Umgang mit der ganzen Bandbreite der Medien dazu, also eine Vermittlung der Politik, die in der starken Konkurrenz der Angebote in allen Kanälen durchdringt. Da hat es in der Tat einen qualitativen Sprung in den letzten zehn Jahren gegeben, der sich natürlich auch mit dem neuen Sitz von Parlament und Regierung verbindet.
Eine persönliche Frage: Wo haben Sie 1991 die Debatte über den Regierungssitz verfolgt – und was haben Sie empfunden?
Ich habe Teile im Fernsehen verfolgt. Für mich war die Debatte ein rhetorischer Höhepunkt des deutschen Parlamentarismus. Fremd wirkt heute das Pathos vieler Reden. Bei einigen hatte man das Gefühl, es geht um Leben oder Tod. Ich habe das immer sehr viel nüchterner gesehen. Das knappe Ergebnis zeigt, wie sehr man sich in der Teilung eingerichtet hatte. Aber natürlich standen starke Interessen in Nordrhein-Westfalen und eine tiefsitzende Skepsis gegenüber allem, was nach Zentralismus wirkt, dagegen.
Was hat der Umzug Berlin genutzt?
Da war zunächst der psychologische Faktor: Die 90er Jahre waren für Berlin verdammt schwere Jahre. Hunderttausende Arbeitsplätze gingen damals verloren. Und da griff man nach jedem Strohhalm. Der Umzug von Parlament und Regierung löste schon eine Aufbruchstimmung aus. Das war die Zeit der Baukräne.
Wie würden Sie den Nutzen aus heutiger Sicht sehen?
Berlin hat national und international wieder eine hervorgehobene Rolle unter den europäischen Hauptstädten. Die Medienpräsenz ist riesig. Verbände und Interessenvertretungen sind der Politik nach Berlin gefolgt. Dadurch entstanden nicht nur neue Arbeitsplätze. Ganz wichtig für Berlin ist auch, dass neue Bevölkerungsgruppen in die Stadt kamen, die sich zunehmend politisch engagieren. Und städtebaulich hat der Umzug einiges bewirkt. Die Reichstagskuppel von Norman Foster ist ein neues Wahrzeichen Berlins und der Republik insgesamt. Ich finde: Berlin ist weltoffener geworden.
Die politische Szene belebt die Stadt – doch die großen Unternehmen sind meist nur mit Repräsentanzen in Berlin vertreten. Ist Berlin als Wirtschaftsstandort nicht attraktiv genug?
Berlin ist ein hoch attraktiver Wirtschaftsstandort. Wir haben schwere Jahre hinter uns. Aber die Berliner Wirtschaft ist heute in weiten Teilen innovativ und wettbewerbsfähig. Durch unsere enorme Dichte an Forschungseinrichtungen sind wir auch vergleichweise gut für eine Krise wie die jetzige gerüstet. Innovationen sind der Schlüssel, um danach besser dazustehen und durchstarten zu können. Berlin ist eine ausgesprochene Wissenschaftsmetropole mit exzellenten Hochschulen. Und natürlich geht es heute auch um die sogenannten „weichen“ Faktoren, die in Wahrheit längst zu harten Faktoren geworden sind: Berlin ist zu einem „place to be“ für Kreative aus aller Welt geworden. Der Freizeit- und Erlebniswert ist immens hoch. Und wir bauen unsere Stärken aus. Ein Beispiel: Unsere neue „Einstein-Stiftung“, mit der wir der Spitzenforschung in Berlin einen zusätzlichen Schub verleihen.
Seit einigen Jahren wird über den Umzug der restlichen Ministerien von Bonn nach Berlin diskutiert. Sie befürworten diesen Umzug, und in Umfragen ist auch die Mehrheit der Ostdeutschen dafür. Wolfgang Thierse sagte, dass die Verteilung der Ministerien auf zwei Städte eine „Fortsetzung der Teilung Deutschlands“ sei. Übertreibt er?
Mein Hauptpunkt sind die immensen Kosten für diesen „Wanderzirkus“ und die Reibungsverluste zwischen den Standorten der Ministerien. Der Kompromiss aus dem Jahr 1991 sollte in einer symbolisch und emotional aufgeladenen Situation die Gemüter beruhigen und eine Balance herstellen, weil für manche Berlin der Inbegriff von Zentralismus war. Heute sind wir die von allen anerkannte Hauptstadt, vor der niemand Angst hat – im Gegenteil. Berlin wird weltweit von vielen Menschen als Hauptstadt eines gastfreundlichen, weltoffenen und friedliebenden Landes in der Mitte Europas wahrgenommen.
Der Umzugsbeschluss sah eine gerechte Verteilung der Regierungseinrichtungen vor. Wäre es Bonn gegenüber fair, jetzt auch die übrigen Einrichtungen dort abzuziehen?
Seien wir doch ehrlich: Eigentlich wollen doch fast alle nach Berlin. Die Ängste vor einem Ausbluten Bonns haben sich als obsolet erwiesen. Bonn hat sich wirtschaftlich hervorragend entwickelt. Und dass im Jahr 20 nach dem Fall der Mauer immer noch mehr als die Hälfte der Verwaltung in Bonn ist, versteht kaum jemand. Ich denke, der nächste Bundestag sollte das Thema pragmatisch und entspannt angehen. Eine neue Entscheidung ist überfällig.
Es heißt, für Russland führe der Weg nach Europa über Berlin. Ist Deutschland durch den Umzug östlicher geworden?
Natürlich spielt die geographische Nähe zu unseren östlichen Nachbarn eine Rolle, besonders zu Polen. Wir arbeiten in der Oderpartnerschaft zusammen. Aber auch die Präsenz von osteuropäischen Einwanderern in Berlin prägt die Wahrnehmung als einer Stadt, die früher einmal der „Ostbahnhof Europas“ genannt wurde. Insgesamt ist nach meinem Eindruck Deutschland internationaler und weltoffener geworden, auch durch den Umzug.
Hat sich seit dem Umzug auch die politische Kultur des Landes Berlin gewandelt?
Die Jahrtausendwende war für Berlin auch politisch eine Zäsur. In diese Zeit fällt der Umzug, aber auch der Beginn eines Mentalitätswechsels in der Berliner Landespolitik. Wir haben uns von der Subventionitis der geteilten Stadt und von den Illusionen der frühen 90er Jahre befreit, als viele glaubten, Berlin würde in kurzer Zeit die Fünf-Millionen-Einwohner-Grenze überschreiten. Wir haben Berlin finanziell weitgehend auf eigene Füße gestellt. Auch die Gewichtung von politischen Themen hat sich verändert. In der geteilten Stadt waren die eigenen Probleme auf der „Insel“ doch sehr beherrschend. Der Berliner Blick hat sich geweitet.
Berlin, so der berühmte Spruch, ist dazu verdammt, immerfort zu werden – und nie zu sein. Wann darf Berlin mal sein, wann ist die Stadt bei sich selbst angekommen?
Berlin ist eine Stadt des raschen Wandels. Das macht die Stadt spannend. Das zieht die Menschen an. Und das wollen auch die Berliner selbst: Wenn es etwas Neues zu „kieken“ gibt, dann ist halb Berlin „uff de Beene“. Aber trotz allem ist Veränderung auch für die Berliner nicht alles. In ihrem Kiez oder ihrer Laube sind sie ganz bei sich. Um den Seelenfrieden der Berliner muss man sich keine Sorgen machen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Bonn.. Das Heft können Sie hier bestellen.