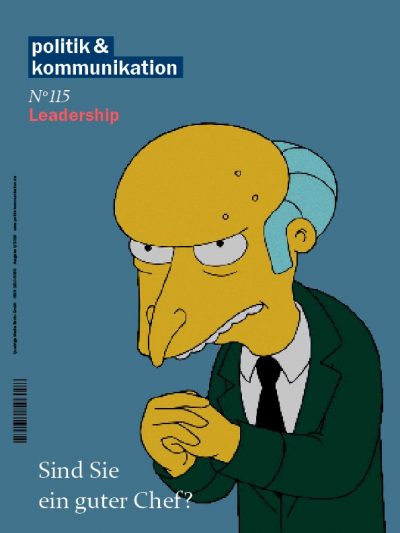Wer Politik macht, benötigt Loyalität. Im ganz großen Maßstab die der Wähler, auf den parteipolitischen Ebenen darunter die der eigenen Mitglieder, Mitarbeiter und Gremien. Loyalität bekommt derjenige, der Erfolg, Aufstieg oder Status verspricht. Insbesondere die SPD kann seit vielen Vorsitzenden ein Lied davon singen. Und das nicht nur bei den Amts- und Mandatsträgern, sondern gleichermaßen in der Mitarbeiterschaft. Was neben einem Erfolgsversprechen Loyalität sichert, wird allerdings nur selten betrachtet.
Ob Loyalität gewährt wird, ist eine Führungsfrage – wiederum im Großen der Wählerschaft wie im Kleinen der Apparate. Beiträge zu politischer Führung gibt es zuhauf, und genauso existieren Abhandlungen über die Loyalität der Ministerialbürokratie speziell nach Regierungswechseln. Sicher ist, dass der bundesdeutsche Beamte selbst in seinen unpolitischsten Zeiten nie dem britischen Whitehall-Ideal des ausschließlich fachlich beratenden unabhängigen Civil Servant entsprach.
Umgekehrt dürfte im Umgang mit Untergebenen im bisweilen noch einem althergebrachten, wenig partizipativen Führungsverständnis anhängenden öffentlichen Dienst kaum reflektiert werden, dass Loyalität einen hohen Preis fordert – und zwar von demjenigen, der Loyalität erwartet. Er sollte nämlich so führen, dass seine Mitarbeiter ihm treu bleiben. Loyalität lässt sich eben nicht per Hausanweisung verordnen, und selbst die verbeamtete Psyche mag gelegentlich in einen Bedürfniskonflikt mit dem Amtseid geraten. Schon die resignative innere Emigration entspricht nicht dem Geist des Dienstrechts.
Psychologie des Einzelnen
Übersehen wird leicht, dass Führung selbst im politischen Feld zunächst einmal weniger mit Ideologie und Inhalten, sondern mehr mit Psychologie des Einzelnen und der kulturellen Prägung von Organisationen zu tun hat. Das ist seltsam, wo es doch gerade in der Politik so “menschelt” wie sonst kaum irgendwo. Zwar finden sich immer wieder Berichte über die schlechte Stimmung in Ministerien, meist im Zusammenhang mit Personalentscheidungen, die wenigstens die Übergangenen am Prinzip der dem Berufsbeamtentum zugrundeliegenden Bestenauslese zweifeln lassen.
Dass Menschen den Eindruck haben, unter ihren Möglichkeiten geblieben zu sein aufgrund von nicht selbst beeinflussbaren Bedingungen, lautet die Erklärung des Soziologen Heinz Bude für die Verbitterung von Teilen der Mittelschicht, die sich teilweise in einem Hang zum Populismus ausdrücken kann. Unter seinen Möglichkeiten geblieben zu sein, wird von manch einem im politischen Berlin mit “B3” übersetzt. Genauso ist der Glaube, es besser zu können als die politisch dafür Gewählten, in Ministerien, politischen Stiftungen und Medien nicht ganz unbekannt. Das Gegenteil davon ist die dortselbst ebenfalls anzutreffende Ergebenheit, ironischerweise ein Synonym für Loyalität.
Es überrascht nicht, dass Führungskräfte gerade in der Politik und ihren Apparaten nicht immer den Anforderungen gewachsen sind. Das unflexible Dienstrecht wie transparente Eingruppierungen schüren Unzufriedenheit bei Mitarbeitern, von denen manch einer alleinig eine eigene Agenda verfolgt; der Kampf um Zuständigkeiten und die mediale Beobachtung können ein Übriges tun. Überdies hat kaum ein Amts- und Mandatsträger wirklich einmal Personalführung erlernen können, zumal dem politischen Betrieb ehrliche, nicht-taktische Anerkennung und emphatische Wertschätzung gegenüber Dritten sowieso in hohem Maße wesensfremd sind.
Die Ansprüche an das Spitzenpersonal sind hoch, denn es muss einerseits die Fähigkeit haben, konstruktiven Widerspruch zu erkennen und zu ertragen, und andererseits resistent gegen Kritik sein. Das kann selbst für das unmittelbare Umfeld gelten, denn es ist an der Tagesordnung, dass sich Mitarbeiter über die Marotten ihrer Chefs wenigstens im engen Kreis mokieren. In dem autobiografischen Roman “Monrepos”, der den Werdegang des späteren Regierungssprechers Manfred Zach im baden-württembergischen Staatsministerium erzählt, findet sich eine zeitlos schöne Szene, ziemlich zu Beginn der Karriere, als der Protagonist dem Zirkel um den Ministerpräsidenten nahe zu rücken beginnt: Auf einer internen Feier wird über den Regierungschef von seinen wichtigsten Beratern gelästert. Dass derartiges, dem jungen Referenten noch ungehörig Erscheinendes, gelegentlich geschehen muss, um loyal bleiben zu können, ist eine kluge Beobachtung: “Es ist ein Akt innerdemokratischer Hygiene, der Platz schafft für neue Loyalität”, erkennt Zach. Es handelt sich dabei um eine Art psychologisch nötige Entlastungstat – deren Inhalt bei einem loyalen Umfeld nicht nach außen dringen wird.
Aufschlussreicher Insiderbericht
Vertrauen zu können, ist ein Schlüssel zu guter Führung – und damit zu Loyalität. Auch um diesen “Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität” (Niklas Luhmann) ist es auf politischem Feld nicht gut bestellt. Und das nicht nur im Verhältnis von Wählern und Gewählten, sondern genauso im ewigen Wettstreit der politischen Akteure untereinander und innerhalb der Organisationen. Der unbedingte Wille, keinesfalls einen Kontrollverlust zu erleiden, diktiert das Handeln. Lesenswert hierzu ist der indiskrete, aber umso interessantere anonyme Insiderbericht über den SPD-Online-Wahlkampf 2009 – unter seinem die Botschaft vorwegnehmenden Titel “No, we can’t” ist er auf der Webseite des “Freitag” noch zu finden. Der Text zeigt, dass der Anspruch, alles zu kontrollieren, führungstechnisch Loyalität untergräbt. Zugegeben, Kontrolle aufzugeben, zu vertrauen, erfordert insbesondere im hochkompetitiven Umfeld viel Souveränität und kollidiert oft mit dem eigenen Selbstbild. Der erste Begrenzer im Möglichkeitsraum, der einem Menschen zur Verfügung steht, ist nun einmal die eigene Psyche. Aber es wäre schon einen Versuch wert, ihn zu erweitern – ein Zuwachs an Loyalität könnte die Belohnung sein.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation II/2016 Leadership. Das Heft können Sie hier bestellen.