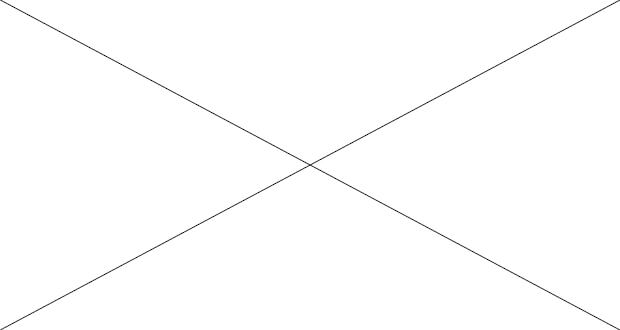Einen reibungsfreien Diskurs dürfen die Zuschauer nicht erwarten. Wenn Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier am Abend des 13. September, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, zum TV-Duell antreten, biegen beide Spitzenkandidaten auf die Gegengerade des Wahlkampfs ein. Für ARD, ZDF, RTL und Sat1, die die Debatte übertragen werden, ist das Duell eine quotensichere Angelegenheit. Doch das Format kränkelt.
Denn ein wenig „Ehen vor Gericht“ ist es auch, wenn die Spitzen des Kabinetts zum Duell antreten. Und so beschäftigen sich im Vorfeld der Sendung viele Kommentare mit der Glaubwürdigkeit der Fernsehdebatte: Jetzt wird auch noch der Streit gespielt? Dass allein das Regierungspaar Merkel und Steinmeier die Legislaturperiode resümiert und sich – in welcher Konstellation auch immer – für weitere Taten empfiehlt, nimmt der Idee etwas die Würze.
Abzug vom Zeitkonto
Welcher Idee eigentlich? Vielleicht der, dass es spannend wäre, wenn sich die aussichtsreichsten Kandidaten vor Publikum gegenseitig politisch filetieren? Dass sie sich zudem den Fragen der Journalisten oder gar Bürger stellen – und sie umfassend, ohne jede Polemik und anschaulich beantworten? Dass also wie beim Häuten einer politischen Zwiebel Stück für Stück die angebotenen Regierungsprogramme freigelegt werden, die Wählerschaft den Kern der Alternativen entdeckt – und die besseren Argumente anerkennt?
All das wäre ein bequemer Maßstab, an dem sich Fernsehdebatten schon messen lassen mussten. Vor allem das Regelkorsett, in das sich die Kandidaten zwängen, bietet einige Breitseite für Formatkritik. Dass etwa die Protagonisten nie oder höchst selten direkt miteinander streiten und stattdessen parallele Pressekonferenzen abhalten, führt unmittelbar vor Augen: Nicht überall, wo Debatte drauf steht, ist auch Debatte drin. Und spätestens, als sich im Jahr 2002 der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder während des Duells mit CSU-Herausforderer Edmund Stoiber vom N24-Journalisten Peter Limbourg sagen lassen musste, unautorisiertes Sprechen würde „vom Zeitkonto“ abgezogen, war sie wieder da: die Medialisierung des Politischen – in Form eines komprimierten 90-Minuten-Wahlkampfs. Kaum denkbar die Haltung des ehemaligen Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger, der sich 1969 einer Fernsehdebatte mit dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt verweigerte; schließlich stünde es „dem Kanzler der Bundesrepublik nicht gut an, sich auf ein Stühlchen zu setzen und zu warten, bis ihm das Wort erteilt wird“.
Die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile wissen die beiden Kanzlerkandidaten, dass sie mit einem TV-Duell die Aufmerksamkeit der Zuschauer – und potenziellen Wähler – auf sich ziehen können. Für die Daheimgebliebenen, im anstehenden Fall also die Opposition, sind die Debatten von daher Albträume. Über 20 Millionen Zuschauer verfolgten im September 2005 das Duell zwischen Schröder und Merkel – zu einem Zeitpunkt, als gut ein Viertel der Wähler noch unentschlossen war. Auch das kommende Aufeinandertreffen dürfte kampagnenstrategisch die Jagdsaison auf die Spätentscheider eröffnen. Damit stellt sich allerdings die Frage, ob solche Sendungen den Wahlausgang tatsächlich beeinflussen können und, wenn ja, wie sich ein solcher Einfluss darstellt.
In den USA haben die Debatten zwischen Richard Nixon und John F. Kennedy im Jahr 1960 nicht zuletzt aufgrund des knappen Wahlausgangs einen gewissen Mythos erlangt. Inzwischen sind die Duelle in den USA fest institutionalisiert – auf allen politischen Ebenen – und spielen auch bei der Kampagnenplanung eine zentrale Rolle. Politik- und Kommunikationswissenschaftler haben in der Folge viel über die Effekte spekuliert. Neben einigen hundert US-Studien zeichnen seit 2002 auch einige deutsche Arbeiten ein differenziertes Bild.
Vorlauf und Verlängerung
In der Regel ist es schwierig, einzelne Gründe für eine Wahlentscheidung zu erkennen. Wahlkampf, seine Aufnahme und die Entwicklung von Wahlabsichten haben Prozesscharakter, den soziale, mediale und kampagnenspezifische Faktoren beeinflussen. Trotzdem lassen sich aus den Studien einige generelle Linien herauslesen.
Für die Beurteilung des Auftritts der Kandidaten in den Debatten spielt vor allem die Stärke von Parteibindung eine zentrale Rolle – der Vertreter der eigenen Seite beziehungsweise sein Auftritt wird meist überdurchschnittlich positiv bewertet, Wahlabsichten, soweit vorhanden, verstärken sich. Dass sich der Anhänger eines Kandidaten, selbst dann, wenn der Gegner stark argumentieren und auftreten konnte, umentscheidet, kommt selten vor.
Stil und Substanz, Auftreten und Programmatik können in erster Linie solche Wähler beeindrucken, die keinem Kandidaten zuneigen oder noch unentschlossen sind. Nachdem die Zuschauer die Debattenleistung der beiden Politiker nach einem Sieg-Niederlage-Schema bewertet haben, treffen sie jedoch nicht zwangsläufig einen entsprechenden Wahlentscheid. Zum einen sind in der Parteienlandschaft der Bundesrepublik solche Debatten in vielerlei Hinsicht unüblich. Unter den Zuschauern befinden sich aber auch Sympathisanten der kleineren Parteien, die aufgrund des Duells nicht die Fahnen streichen werden. Zum anderen ergänzt die Gewinn- und Verlustrechnung des Auftritts nur eine lange Liste anderer Kriterien, die bestimmen, wo die Bürger am Wahltag ihr Kreuz machen.
Darüber hinaus ist das politische Publikum mediensozialisiert. Es beurteilt den Auftritt der Staatsschauspieler als Auftritt und unterscheidet zwischen dem persönlichen Abschneiden der Kandidaten und dem politischen Gehalt dahinter – was die mediale Begleitung der Debatten zusätzlich befördert. Entsprechende Schlachtbeschreibungen und Diskussionen vor und nach dem Duell können das Urteil über die Leistung der Politiker beeinflussen. Besonders groß ist die Überraschung, wenn Kommentatoren von einem „abweichenden Verhalten“ sprechen: Wenn etwa ein als blass erwarteter Kandidat die andere Seite in Grund und Boden debattiert oder wenn etwa ein Lapsus, eine Ungenauigkeit, ein Fauxpas von den Medien aufgegriffen und immer wieder gezeigt wird. Debatten haben einen Vorlauf und gehen immer in die Verlängerung.
Wie gesagt: Anhänger der Gegenseite über ein solches Duell überzeugen zu wollen, ist in der Regel vergebene Liebesmüh. Tatsächliche Auswirkungen auf die Wahlentscheidung zeigen sich vor allem in der Gruppe der politisch mehr oder weniger Desinteressierten – soweit sie überhaupt vor dem Fernseher sitzen und nicht angesichts der geballten Sendermacht, die das Ereignis überträgt, ins Freie flüchten. Klar ist aber auch: Soweit sich tatsächlich Effekte nach der Debatte oder den darauffolgenden Diskussionen zeigen, erweisen sie sich als kurzfristig, sie versanden. Vierzehn Tage vor der Wahl sind ein recht langer Zeitraum. Kurzum: Die konkreten Auswirkungen von TV-Duellen sind gering – was bei knappen Urnengängen trotzdem entscheidend sein kann.
Immerhin fühlt sich das Publikum durch die Fernsehdebatten politisch informiert und äußert sich deswegen positiv darüber. Allerdings ist da noch reichlich Raum: Etwa ein Drittel des Publikums gewinnt den Duellen meist eher wenig ab. In der Tat ließe sich hier auch über andere, Spontaneität fördernde Formate nachdenken, etwa im Stil des US-amerikanischen „Town-Hall-Meetings“, über größere Runden oder darüber, ob nicht andere Organisationen als die Fernsehsender die Aufeinandertreffen verantworten könnten.
Interesse am politischen Streit
Es bleibt fraglich, inwiefern entsprechende Änderungen den Hang deutscher Politiker, das Wahlprogramm zu verkünden, durchbrechen würden. Zurzeit taucht bei solchen Gedankenspielen immer auch der US-Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama auf. Oft wird dabei ein anderes Merkmal seines Wahlkampfs übersehen: sein rhetorischer Stil, mit dem er auch in den TV-Debatten punkten konnte. Obama kann mit seiner Argumentationsweise, durch das Abwägen von Pro und Contra, der Auseinandersetzung mit Gründen, Folgen und Kosten politischer Alternativen, das Publikum in seine Entscheidungsfindung miteinbeziehen. Ein solcher Politikstil würde – jenseits aller Fernsehformate – der politischen Kultur in Deutschland nicht nur gut zu Gesicht stehen, er könnte auch mehr Interesse und Gefallen am politischen Streit hervorrufen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Jetzt aber los! – Endspurt zur Bundestagswahl. Das Heft können Sie hier bestellen.