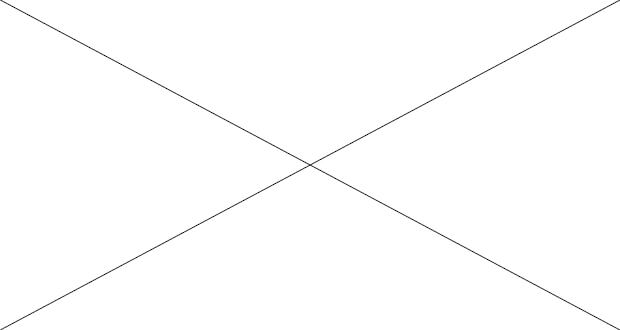So etwas hatte es in Deutschland noch nicht gegeben. Am 5. Oktober traten Angela Merkel und Peer Steinbrück im Bundeskanzleramt vor die wartenden Journalisten. Die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister sahen erschöpft aus. Über Nacht hatten sich beim Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate (HRE) neue Milliardenlöcher aufgetan und das Rettungspaket, das der Bund und die deutschen Banken geschnürt hatten, zum Platzen gebracht. Merkel und Steinbrück wussten: Das Vertrauen der Bundesbürger in das deutsche Finanzsystem hing zu diesem Zeitpunkt davon ab, wie das Problem der taumelnden HRE gelöst werden würde. Die Bundeskanzlerin versuchte zu beruhigen: „Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.“ Und Steinbrück fügte mit grimmiger Mine an, dass er „ziemlich entsetzt“ sei über das neue Liquiditätsloch beim Immobilienfinanzierer.
Die Medien berichteten am nächsten Tag intensiv über die so genannte „Merkel-Garantie“, die Staatsgarantie für alle privaten Spareinlagen. Klar ist: Mit ihrem energischen Auftritt konnten beide Politiker in der Finanzkrise punkten – auch deshalb, weil die Banken schwere Fehler bei ihrer Krisen-PR machten.
„Dieser Auftritt war damals das zentrale Element, um eine Panik in Deutschland zu verhindern“, sagt Klaus-Peter Johanssen, Gründer und ehemaliger Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Johanssen + Kretschmer. Zu diesem Zeitpunkt sei es zunächst wichtig gewesen, Vertrauen in das Finanzsystem zu schaffen. „Besser hätte die Bundesregierung das nicht machen können.“ Johanssen hat Erfahrung in der Krisen-PR: Während der Brent-Spar-Krise im Jahr 1995 arbeitete er als Kommunikationschef für Shell Deutschland. „Psychologie spielt in diesem Zusammenhang die größte Rolle. Die Politik muss den richtigen Ton treffen und die richtige Aktion starten“, sagt er. Mit der Kommunikationsstrategie der Banken geht Johanssen hart ins Gericht: „Sie haben versagt. Dafür gibt es eine Menge Beispiele, sogar bis in die jüngste Vergangenheit.“ Dass Geldinstitute heute mit Sätzen wie „Jetzt kommt es auf gute Beratung an!“ für sich werben würden, hält er für „zynisch“.
Der Bundesverband deutscher Banken sieht das sicherlich anders. Oder? Die Frage muss offenbleiben. In der Pressestelle des Verbands heißt es lediglich, dass es zurzeit einen Wechsel in der Geschäftsführung gebe, ein Ansprechpartner für die Kommunikationsstrategie fehle daher. „In diesem Fall können wir Ihnen leider nicht weiterhelfen.“ Durch ihre fehlende Kommunikation verpassen die Banken die Chance, den Vorwurf, sie seien Verursacher der Krise, zu widerlegen. Die Regierung nutzt das – und präsentierte sich als zupackender Problemlöser.
Kein Stein mehr auf dem anderen
Auch der Vorsitzende des Haushaltsauschusses im Deutschen Bundestag, Otto Fricke, kritisiert die Informationspolitik der deutschen Banken. Nur „scheibchenweise“ hätten sie über ihre tatsächlichen Probleme Auskunft gegeben, als „Salamitaktik“ bezeichnet Fricke das. Dieses Vorgehen erkennt der FDP-Politiker aber nicht nur bei den Geldinstituten. „Transparent haben die Banken nicht gearbeitet, transparent hat aber auch die Bundesregierung nicht gearbeitet.“ Die „Merkel-Garantie“ nennt Fricke noch eine „Beruhigungspille zur richtigen Zeit“, doch der darauf folgenden Krisenkommunikation von Schwarz-Rot kann er nicht viel abgewinnen.
Der FDP-Politiker erinnert an die Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag im November 2008. Damals habe er Finanzminister Steinbrück gefragt, ob er weiterhin davon ausgehe, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent wachse. Steinbrück antwortete, dass er „optimistisch“ denke und die 0,2 Prozent weiter möglich seien. „Da hat die Regierung hochnäsig gehandelt. Sie wusste damals, dass Deutschland durch die Probleme auf dem US-Markt kräftig geschädigt werden würde“, sagt Fricke. Tatsächlich ging die EU-Kommission zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Stagnation der deutschen Wirtschaft aus, die Weltbank gar von 0,9 Prozent Rückgang. Fakt ist: Ende April erklärte die Bundesregierung, dass das BIP voraussichtlich um 6 Prozent schrumpfen werde. Das wäre der schwerste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik.
Für Brigitte Weining ist dieser historisch einmalige Charakter der Finanzkrise ein wichtiges Kriterium. Die Journalistin, die bis vor kurzem für das ZDF täglich von der Börse in Frankfurt berichtete, sagt, „dass der Zeitdruck bei dieser weltweiten Wirtschaftskrise enorm war“. Die Politiker mussten versuchen, viele Brände auf einmal zu löschen. Für Weining nahm die Krise am 15. September 2008 eine neue Dimension an. An diesem Tag musste die viertgrößte US-amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz anmelden, die US-Regierung hatte eine Rettung der Bank abgelehnt. „Bei dieser Bank sind die meisten Experten davon ausgegangen, dass sie einfach nicht pleite gehen kann.“ An diesem Tag war für Weining klar: „Jetzt ist alles möglich. Nichts steht mehr an seinem Platz, kein Stein mehr auf dem anderen.“ Sie vergleicht die damalige Situation mit einer Nebelbank auf einer vierspurigen Autobahn. „Da bremst jeder, und bis wieder alles in Bewegung kommt, dauert es sehr lange.“ Weining sagt, dass die Bundesregierung die politischen Maßnahmen gegen die Finanzkrise „ganz gut kommuniziert hat“. Erfreulich sei es gewesen, dass Union und SPD in der Krise die politischen Streitpunkte außen vor gelassen hätten.
Miriam Melanie Köhler, Mitherausgeberin des Handbuchs „Regierungs-PR“, bezeichnet diese Geschlossenheit als einen wichtigen Faktor bei der politischen Krisenkommunikation. Köhler nennt das „One-Voice-Policy“ und meint damit, dass es für die Regierungsparteien wichtig ist, sowohl politisch als auch kommunikativ eine gemeinsame Linie herzustellen. „Bei mehreren Parteien und involvierten Ministerien eine schwere Aufgabe.“ Konnte die schwarz-rote Koalition in Berlin diese Aufgabe lösen? Köhler: „Die relativ umfangreiche Kommunikation über die Konjunkturpakete ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Die Bevölkerung muss wissen, was die Regierung in der Krise unternimmt.“ Nur so könne sie Vertrauen schaffen.
Beispiel Bundesfinanzministerium: Peer Steinbrücks Haus hat sich bei seiner Krisen-PR nicht nur auf die herkömmlichen Mittel wie Plakate, Broschüren und das Internet verlassen. Bundesweit ließ es Brötchentüten und Pizzaboxen verteilen, auf denen es Werbung für seine Webseite machte. „Natürlich kann man darüber streiten, ob das die besten Instrumente sind, um der Bevölkerung die Maßnahmen gegen die die Wirtschaftskrise zu erklären“, sagt Köhler, „aber wichtig ist, dass kommuniziert und die Krise nicht totgeschwiegen wurde.“ Kontroverse Gesetze und die Regierung bleibt stumm? Ein Vorwurf, der beispielsweise der rot-grünen Regierung unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder gemacht wurde, als es darum ging, die Ziele der „Agenda 2010“ zu erklären.
Der damalige Regierungssprecher Béla Anda sieht das anders. „Die aktuelle Bundesregierung konnte mit ihrer Kommunikation Erfolge erzielen, weil die Koalition die Entscheidungen mitgetragen hat. Das war bei der Agenda 2010 nicht so.“ Viele Abgeordnete der eigenen Koalition hätten die Reformen abgelehnt und das auch öffentlich kundgetan. „Gleichzeitig hat die rot-grüne Regierung bei der Umsetzung der Agenda 2010 die Arbeit mehrerer Ressorts koordinieren müssen. Es galt, ein ganz neues Haus aufzubauen“, sagt Anda, der 2006 als Kommunikationschef zum Finanzdienstleister AWD wechselte.
Was macht für den ehemaligen Springer-Journalist eine erfolgreiche politische Krisen-PR aus? Anda: „Wichtig ist, dass eine Regierung fortlaufend unterrichtet, auch bei schlechten Entwicklungen. Gleichzeitig sollte sie bestimmten Ereignissen bisweilen nicht vorgreifen.“ Kämen im März neue Zahlen über die wirtschaftliche Entwicklung heraus, dürfe sich die Regierung der Ergebnisse nicht bereits im Januar öffentlich bedienen.
Miriam Melanie Köhler hat bei der Großen Koalition einen weiteren klugen Schachzug in der Krisenkommunikation erkannt. Köhler sagt, dass es strategisch geschickt war, die Gewerkschafts- und Wirtschaftsvertreter in die politischen Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. „Sie wurden frühzeitig informiert und konnten so als Multiplikatoren dienen.“ So hätte es zu beiden Konjunkturpaketen, sei es vor der Planung oder nach der Verabschiedung, große Runden im Kanzleramt gegeben, zu denen die wichtigsten Vertreter der Unternehmen und Gewerkschaften geladen waren.
Im Februar dieses Jahres, kurz bevor der Bundestag das zweite Konjunkturpaket verabschiedete, musste die Bundesregierung zusätzlich eine personelle Krise meistern. Am 7. Februar bat der damalige Bundeswirtschaftsminister Michael Glos dem CSU-Chef Horst Seehofer seinen Rücktritt an. Seehofer zögerte und schlug erst zwei Tage später CSU-Generalsekretär Karl-Theodor zu Guttenberg als Nachfolger vor. Kaum war zu Guttenberg im Amt, befasste er sich öffentlichkeitswirksam mit strittigen Themen wie Staatshilfen für den Autobauer Opel, Enteignung der HRE-Bank oder Abwrackprämie. Glos wirkte als Bundesminister oft glücklos und überfordert, in der Wirtschaftskrise konnte er sich öffentlich kaum durchsetzen.
Krise als Normalzustand
Zu Guttenberg punktete hingegen schnell mit seinem professionellem Auftreten. Die deutsche Wirtschaft freute sich, dass zu Guttenberg ihre Interessen endlich wieder in der breiten Öffentlichkeit vertrat. Das Ergebnis: Schon Ende März, noch keine acht Wochen im Amt, stand er im ZDF-Politibarometer auf der Skala der zehn beliebtesten Politiker auf Platz 3. Selbst Otto Fricke von der oppositionellen FDP kommt nicht umhin, zu Guttenberg zu loben. „Er ist kommunikativ, er hat eine Sprachenbegabung, und er ist gut vernetzt.“ Mit seinen öffentlichen Auftritten zeige er, wie wichtig Psychologie in der Wirtschaft ist. Doch Fricke ist sich sicher: „Er hatte einen guten Start, aber wie gut er wirklich im Amt ist, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen.“
Holger Lösch, Leiter Kommunikation und Marketing beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), teilt die Einschätzung des FDP-Haushaltspolitikers. „Zu Guttenberg hat in einer Phase, in der die Dinge sehr schwierig waren, eine Dynamik geschaffen und Vertrauen und positive Reaktionen in der Wirtschaft ausgelöst.“ Lösch vergleicht das mit einer Einwechslung beim Fußball. „Plötzlich war ein neuer und frischer Spieler auf dem Feld. Das kann manchmal Wunder bewirken.“ Trotzdem habe zu Guttenberg die gleichen Probleme wie Glos und müsse auf sie mit den gleichen Mitteln reagieren. „Daran wird er sich am Ende messen lassen müssen.“
Lösch betrachtet die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise als eine kommunikative Ausnahmesituation. „In der Regel ist Krisenkommunikation ein akutes und auf kurze und intensive Phasen beschränktes Geschehen. Aktuell ist es aber so, dass die Krisenkommunikation zum Dauerzustand geworden ist, zum Normalfall.“ Es scheine zurzeit so, als ob es gar nichts anderes mehr zu kommunizieren gebe. „Das Problem, das wir haben, ist, dass wir keine einzelne große Katastrophe haben, sondern viele verschiedene Katastrophen, die die Kommunikatoren jeden Tag aufs Neue herausfordern“, sagt Lösch. Und das gelte nicht nur für die Politik, sondern auch für Wirtschaft, Medien und Verbände. Blickt Lösch auf den bisherigen Verlauf der Finanzkrise zurück, fällt ihm vor allem ein Tag ein. „Ich denke an eine Sitzung der BDI-Vizepräsidenten im Herbst 2008. Was mir damals auffiel, war eine enorme Veränderung der Stimmung und der Wahrnehmung gegenüber vorangegangenen Sitzungen. Alle Teilnehmer waren sehr ernst.“ Während dieser Sitzung habe er erkannt, was für Auswirkungen die Krise auf die Realwirtschaft habe.
Welche Rolle spielt die Wahl?
Auch durch eine ausgeklügelte Krisenkommunikation kann die Bundesregierung die psychologischen Auswirkungen der Finanzkrise auf die Republik höchstens abmildern. „Der Spiegel“ bezeichnete die Finanzkrise Ende April als die „schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression“. In der Bevölkerung ist die Verunsicherung groß: Mitte Mai führte das Forsa-Institut im Auftrag von „RTL Aktuell“ eine Umfrage zur Krise durch, bei der 40 Prozent der Befragten sagten, dass sie Angst vor der Folgen des wirtschaftlichen Abschwungs haben. Gleichzeitig waren 75 Prozent der Bürger der Meinung, dass die Bundesregierung nicht ausreichend erklärt, was sie gegen die Wirtschaftskrise unternimmt.
Claus Zemke leitet die Gruppe Koordination im Bundespresseamt (BPA). Er arbeitet in dem Amt, über das die Bundesregierung die Öffentlichkeit über ihre Arbeit informiert. Zemke sagt, dass das BPA seinen Schwerpunkt vor allem auf den „klassischen Bürgerservice“ gelegt habe. „Wir wollten einerseits einen Überblick geben, was die Bundesregierung gegen die Krise unternimmt; andererseits standen aber auch konkrete Bürgerfragen im Vordergrund, beispielsweise nach der Abwrackprämie.“ Das BPA habe mit seiner neuen Seite www.konjunkturprogramm.de als Web-Portal Informationen mehrerer Behörden gebündelt, um den Menschen den Zugriff zu erleichtern. „Und das mit Erfolg“, sagt Zemke. Seit Ende vergangenen Jahres hätten sich die Zugriffzahlen auf die Webseite des BPA um rund 40 Prozent erhöht.
Für Peter Kruse, geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens Nextpractice, ist diese Art der Öffentlichkeitsarbeit der falsche Weg. Zu kleinteilig sei die Krisenkommunikation gewesen. „Die Bundesregierung hat lediglich über die entstandenen Probleme innerhalb des bestehenden Finanzsystems aufgeklärt“, sagt Kruse. Er sagt dazu „sich auf die gegebenen Regelwerke beschränken“. Die Grundfragen habe die Koalition nicht gestellt. Für den Psychologen ist die Krise in erster Linie eine „Krise der Entscheider“. Laut Kruse haben die Akteure in Wirtschaft und Politik kaum noch die Möglichkeit, die gesteigerte Komplexität der Systeme zu verstehen. „Besonderes die Finanzwelt hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker miteinander vernetzt und damit eine Explosion von Komplexität und Dynamik bewirkt. Damit wachsen auch Instabilität und Unvorhersagbarkeit in den Systemen.“ Die Schere zwischen der Wirkungskraft getroffener Entscheidungen und dem Verständnis der Folgen habe sich „bedenklich weit geöffnet“. Doch dieses Dilemma hätte den Politikern auch eine Chance geboten – die diese ungenutzt ließen. „Das Versagen der Regelwerke hat der Politik die historische Chance eröffnet, mit den Menschen einen Diskurs über die Basiswerte unserer Gesellschaft zu beginnen.“ Kruses Wunsch nach politischer Ehrlichkeit klingt überzeugend, realistisch ist er vier Monate vor der Bundestagswahl nicht.
Die Börsenexpertin Brigitte Weining sieht die Art, wie die Bundesregierung in den kommenden Wochen kommuniziert, als ausschlaggebend an. „Die Große Koalition muss weiterhin zusammen an der Bekämpfung der Krise arbeiten.“ Denn diese komme mit den Themen Entlassungen und Arbeitslosigkeit nun erst so langsam bei den Menschen an. „Politisches Taktieren wäre jetzt der falsche Weg“, sagt Weining.
Deutschland im Jahr 2009: Die Politik verzichtet auf das traditionelle Wahlkampfspektakel und sagt den Bürgern ohne Umwege, was sie politisch plant. Auch so etwas hätte es in Deutschland noch nicht gegeben.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Wahlkampf – Diesen Sommer in Ganz Deutschland. Das Heft können Sie hier bestellen.