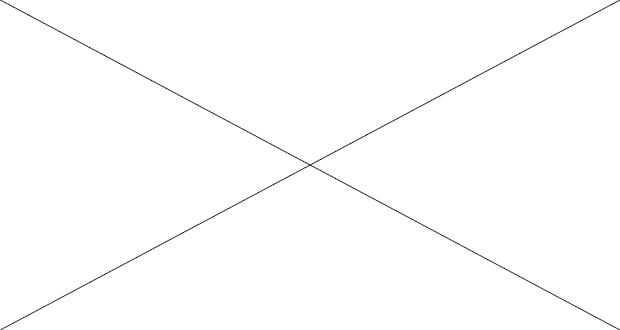London vor einem Jahr: Nach zehn Jahren Amtszeit verlässt Tony Blair die Downing Street wie ein alternder Popstar. Der neue Premier Gordon Brown schätzt das Rampenlicht nicht. Schon bei seiner Antrittsrede steht er wenig kameratauglich am falschen Mikrofon. Nun sei Schluss mit Politik als Promi-Schaulaufen, verkündet er: Sachpolitik zählt. Die Medienberater seines Vorgängers hat er hinausgefegt und durch Finanzfachleute ersetzt. Die Journalisten in London sind ähnlich entzückt wie ihre deutschen Kollegen, als 2005 Angela Merkel Kanzlerin wird: endlich Schluss mit den Egomanen in der Regierungszentrale, endlich wieder Alltagspolitik als Trockenbrot.
Die Egomanen, so schien es, hatten die Spin Doctors mitgebracht. Die permanente Pflege des eigenen Außenbilds prägte die Regierungsstile Blairs und Schröders – dazugehöriges medienaffines Personal inklusive. Das sorgte auch für Berichterstattung: In den britischen Zeitungen explodierte die Zahl der Nennungen des Begriffs „Spin Doctor“ von acht im Jahr 1989 auf 529 ein Jahrzehnt später. In Deutschland kam das Wort mit dem Wahlkampf 1998 in Mode – plötzlich wollte jeder Pressestellen-Praktikant ein Medien-Machiavelli sein.
Doch wer genauer hinsieht, merkt schnell, dass es sich mit dem Spin Doctoring so verhält wie mit der Freundschaft von Schröder und Blair: große Worte, wenig dahinter. In Gesprächen wollte 2003/2004 kaum jemand der 50 für eine Studie interviewten PR-Experten und Journalisten in London und Berlin den Begriff „Spin Doctor“ überhaupt nur in den Mund nehmen. Die Gesprächspartner, darunter der damalige deutsche Regierungssprecher Béla Anda oder der ehemalige Thatcher-Berater Lord Timothy Bell, stellten ihn als künstlich aufgeladenen Begriff dar – ohne dass eine Definition möglich war.
Keine Politik ohne Spin
Doch es lohnt sich, hinter den Schleier des Spin zu schauen. Denn hier steckt das Grundgesetz der postmodernen Mediendemokratie: Kein Politiker kommt mehr ohne den Dreiklang aus strategischer Planung der eigenen Botschaften, der entsprechenden Präsentation und großer Reaktionsschnelle aus. Wer das vernachlässigt, kommt im schnellen Strom der 24-Stunden-Nachrichten sofort ins Trudeln. Wer für die Politiker diese PR-Planung übernimmt, ist schon wieder zweitrangig.
In den 90er Jahren herrschte noch der Rausch des Neuen: Auf einmal war durch Nachrichtensender und Internet der Blick der Medien wirklich ständig auf die Regierung gerichtet. Nun lauerten die Journalisten nicht jeden Tag, sondern stündlich auf den neuesten Reißer. „Die Medien sind ein hungriges Biest, das jeden Tag fressen will“, sagt der Politikchef der Londoner „Sun“, George Pascoe-Watson. „Wenn die Regierung keine Storys für mich macht, dann finde ich eben etwas anderes, was ich in die Zeitung stecken kann.“
Kommunikation schien alles
Die so genannten Spin Doctors der frühen Schröder-Blair-Jahre hatten das wohl verstanden – und griffen zur Selbstinszenierung: Blairs Sprecher Alastair Campbell ließ sich tagelang von der BBC bei der Arbeit filmen und wies vor laufender Kamera den eigenen Chef zurecht. Der Berater des Bundesfinanzministers, Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, referierte in Interviews über die Marke Hans Eichel.
Kommunikation schien plötzlich alles, sachliche Entscheidungen kamen dahinter. So verriet 2004 ein Kanzlerberater, dass die Umsetzung von Hartz IV technisch so schwierig sei, dass Experten geraten hätten, sie um ein halbes Jahr zu verschieben. Doch das sei kommunikativ einfach nicht möglich gewesen, Probleme für die Arbeitslosen habe man lieber in Kauf genommen: „Das Schlimmere wäre sicherlich die Botschaft, wir kehren um.“
Und in London berichtete ein früherer Mitarbeiter Blairs, wie er jeden Tag nach medienwirksamen Initiativen gierte: „Du musst auf der Titelseite bleiben. Es ist unsere Aufgabe, dass der Premierminister immer so aussieht, als hätte er eine neue Lösung parat.“
Nicht umsonst hatte Blair-Sprecher Campbell ab 1997 allen Untergebenen eingeschärft, Sachpolitik und PR seien zwei Seiten derselben Medaille. Dieses Mantra zeigt auch deutlich, wie unterschiedlich Blair und Schröder agierten. Blair baute nicht nur die PR-Stäbe im gesamten Regierungsapparat aus und besetzte die Spitzen oft mit Ex-Journalisten. Unter ihm wurde die offizielle Medienarbeit zu einer 24 Stunden aktiven, schnellen Maschinerie. Blair achtete auch darauf, dass die langfristige, strategische Planung der eigenen Politik und Kommunikation nicht zu kurz kam. Die Kernbotschaften der Labour-Regierung sind nicht zufällig bis heute gleichgeblieben.
Interesse erlahmt
In Schröders Kanzleramt verschwand hingegen 2002 die Planungsabteilung. Der Kanzler entschied meist situativ – „Tagebau nach Morgenlektüre“, wie ein Berliner Journalist im Interview spöttelte. Der „Medienkanzler“ vertraute mehr auf sein eigenes Charisma als auf institutionelle PR-Planer und Berater. So kann es nicht verwundern, dass die Grundbotschaften von Rot-Grün so häufig wechselten – was den Eindruck des Chaos verstärkte. Immer erst nach Krisen wurde die PR-Arbeit der Bundesregierung modernisiert, oft nach den Vorbildern in England und den USA.
Nun ist das mediale Interesse am Spin Doctor erlahmt. Zwar ernannte der „Spiegel“ Schröders und Merkels Vize-Regierungssprecher Thomas Steg zu einem eben solchen, fügte aber gleich hinzu, das Wort vermische Anerkennung und Verachtung. Steg beherrsche es, Regierungshandeln so zu erklären, dass es interessant klinge – als ob Regierungssprecher nicht schon früher genau dieses Talent mitbringen mussten.
Das ständige Gerede vom Spin Doctor mag verstummt sein, doch ist es kein Zufall, dass sich heute mehr PR-Planer und journalistische Berater in Ministerbüros tummeln als je zuvor. Ob Merkel, Steinmeier, Steinbrück oder Gabriel – sie alle setzen auf strategische Berater mit einem Händchen für die Kommunikation. Die SPD sucht schon für ihren Wahlkampf nach einem Strategiechef, den man aber bitteschön nicht Spin Doctor nennen soll.
So sehr sich auch Merkel und Brown von den Regierungsstilen der Vorgänger abgrenzen wollen, die kommunikativen Lehren haben sie verinnerlicht. Die Pressestellen in den Regierungszentralen behalten nun die Medienberichterstattung gut im Auge: Bis eine im Internet herumgeisternde Falschmeldung dementiert ist, müssen Hauptstadtjournalisten oft nur noch 15 Minuten warten.
Nur: Das geschieht geräuschlos, ohne dass die PR-Experten im Bild erscheinen. Sie sind wieder graue Eminenzen – ganz wie früher. Doch mehr denn je gelingt Politik dann, wenn überlegte strategische Planung und unaufdringliche Imagepflege eine Einheit bilden. Das ist die notwendige Basis, um mit taktischer Schnelligkeit und einem Schuss professioneller Metakommunikation zu glänzen.
Wer glaubt, dass die Nachrichtenmedien, die von Thema zu Thema hüpfen, es der Politik leichter machen, sich durchzuwursteln, irrt. Wenn sich plötzlich das volle Scheinwerferlicht auf einen Minister richtet, reicht nicht nur die kamerafreundliche Siebensekunden-Antwort. Es muss auch die Story dahinter auf Abruf bereitstehen. Bei aller Oberflächlichkeit wird Tiefe gerade dann wichtig, wenn das geballte Interesse für ein paar Stunden oder Tage da ist.
Nach einem Jahr als Premierminister leidet Gordon Brown nun an massivem Popularitätsschwund. Sein mangelndes Kommunikationstalent gilt nicht mehr als liebenswert-schüchtern, sondern als verschroben-misanthropisch. Nachdem er die Regierungszentrale in 10 Downing Street nicht in den Griff bekommen hatte, ließ er zu Beginn des Jahres die alten Ökonomen-Freunde ziehen. Ein neuer Stabschef soll als strategischer Lenker wirken: Die Wahl fiel auf Steven Carter, bis dato Chef einer großen PR-Agentur. BBC-Kameras wird Carter aber so schnell nicht einladen – er wirkt lieber im Verborgenen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Rutschgefahr – bitte bleiben sie politisch korrekt. Das Heft können Sie hier bestellen.