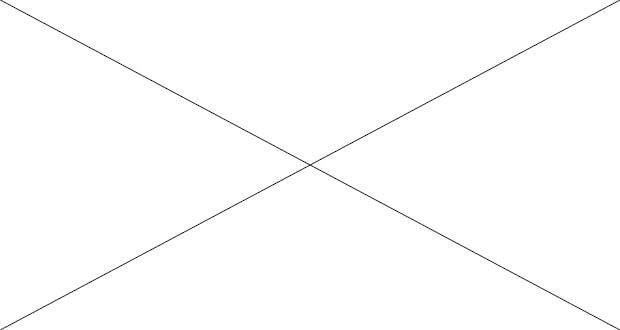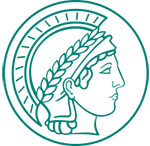Anderthalb Stunden dauert die Autofahrt von Orlando nach Tampa im US-Bundestaat Florida. Der „Sunshine State“ im Süden zählt zu den wichtigsten Staaten im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Unvergessen bleiben bis heute das Wahldrama und der hauchdünne Vorsprung aus dem Millenniumsjahr, der George W. Bush die Präsidentschaft sicherte. Aber auch bei allen Präsidentschaftswahlen seit dem Jahr 2000 haben sich die Floridians durch ihr hohes Maß an politischer Flexibilität ausgezeichnet. Kein Wunder, dass sowohl die Kampagnen der republikanischen Kandidaten als auch Amtsinhaber Obama dem „Southern Swingstate“ eine besondere Bedeutung zumessen.
Gehörte man zu den Millionen von Autofahrern, die jeden Morgen und Abend zwischen den Städten pendeln, konnte man vor dem republikanischen Vorwahltermin am 31. Januar dieses Jahres neben gelegentlichen Musiktiteln vor allem politische Werbebotschaften auf allen Radiokanälen hören. Ein Radiospot beschrieb den republikanischen Kandidaten Newt Gingrich als einen skrupellosen Geldhai, der vor der Verstaatlichung der Immobilienfirma Freddie Mac und Fannie Mae noch schnell 1,6 Millionen Dollar Beratungskosten kassierte – und das als gelernter Historiker. Damit war die Botschaft der Romney-Kampagne einleuchtend: Dieser Kandidat ist tief verwurzelt in der verrauchten Hinterzimmerpolitik Washingtons und somit für das Weiße Haus moralisch ungeeignet. Dieses Beispiel steht exemplarisch für eine Medienschlacht, die Millionen an Dollar verschlingt, Tausende von Negativbotschaften produziert und in die derzeit noch eine Handvoll Kandidaten involviert ist.
Kampagnen werden schmutziger
„Bad news are good news“ – diese allgemein bekannte Medienweisheit gilt auch in der politischen Kommunikation der Vereinigten Staaten. Das stark wettbewerbsorientierte Mediensystem der USA fordert Kontroversen, und die Kampagnen liefern diese. Sie brauchen die Massenmedien als Mittler ihrer Botschaft, und der öffentlichen Wahrnehmung zuliebe werden Kampagnen in den USA tendenziell immer schmutziger.
Negativkampagnen sind tief in der amerikanischen Wahlkampfkultur verwurzelt. Die Diskussion um die schmutzigen Wahlkämpfe ist so alt wie die Demokratie an sich. Denn zum Negative Campaigning gehört es eben auch, den politischen Gegner zu beschuldigen, Negative Campaigning zu betreiben. Manche Angriffe der Vergangenheit gehören heute zum kommunikationspolitischen Kulturgut der USA: Mit einem nur einmal ausgestrahlten TV-Spot schaffte Lyndon B. Johnson 1964 einen erdrutschartigen Sieg gegen Barry Goldwater im Rennen um die Präsidentschaft. In diesem Spot wird die Gefahr eines nuklearen Krieges beschworen – falls Goldwater gewählt wird. Die implizite und doch kontroverse Botschaft erregte eine so massive Aufmerksamkeit der Medien, dass der Spot wieder und wieder in Fernsehsendungen gezeigt wurde, er prägte sich in das politische Gedächtnis einer Generation ein. Ähnlich erfolgreich war die Kampagne von George Bush senior im Jahr 1988: Der nicht minder bekannte Willie-Horton-Spot gegen Michael Dukakis verhalf Bush zum Sieg im Rennen um das Weiße Haus. Hauptwahlkampfthema war die Bekämpfung der Kriminalität. Die Bush-Kampagne schaffte es, die politische Einstellung von Dukakis auf den Fall Horton herunter zu brechen und den Wähler emotional anzusprechen. Horton war ein wegen Raubmords zu lebenslänglicher Haft verurteilter Krimineller, der – während Dukakis Amtszeit als Gouverneur – einen ihm gewährten Hafturlaub zur Flucht nutzte und anschließend eine Frau vergewaltigte. Außerdem misshandelte er deren Mann schwer, ehe er gefasst werden konnte.
Schuss kann nach hinten losgehen
Diese Beispiele zeigen vor allem eins: Negative Campaigning funktioniert. Wahlkampagnen haben die Funktion, Wahlen zu gewinnen. Mit Negative Campaigning steht ihnen ein effektives Werkzeug zur Verfügung, das schon seit Beginn der Wahlkampfauseinandersetzung in den USA zum Einsatz kommt.
Trotzdem ist Vorsicht geboten: Denn der Angriff kann auf den Angreifer zurückschlagen, was desaströse Auswirkungen hat. Um diesen Bumerangeffekt zu vermeiden, haben sich verschiedene Strategien herausgebildet: Erstens greift der Kandidat nicht selbst an, sondern überlässt diese Arbeit einem ihm nahestehenden „Political Action Comittee“ (PAC), das als ausgelagerte Kampagnenorganisation dem Kandidaten Schützenhilfe leistet. Zweitens wird Humor häufig als Stilmittel eingesetzt. Angriffe werden drittens mit Quellen belegt, und viertens erfolgen nicht ausschließlich Angriffe, sondern die Kampagnenmacher stellen darüber hinaus vergleichend auch die eigenen Positionen dar. Diese Strategien beruhen auf der einfachen, jedoch unmissverständlichen Binsenweisheit, an der keine Kampagne vorbei kommt: Sage die Wahrheit und prüfe die Fakten! Jeder Angriff muss detailliert belegbar sein und zu einhundert Prozent der Wahrheit entsprechen. Ansonsten fliegt der Bumerang zurück, zerstört die eigene Kampagne und schlimmstenfalls die Reputation des eigenen Kandidaten.
Deswegen sind die Warnungen, Negative Campaigning sei eine Gefahr für die Demokratie, zu bezweifeln. Amerikanische Studien über den Effekt von Negative Campaigning auf die Wahlbeteiligung widersprechen sich: Die einen sehen bei einem besonders harten Wahlkampf die Wahlbeteiligung sinken. Andere sehen sie gerade wegen der Kontroverse steigen. Grundsätzlich sollte man sich deshalb bewusst machen, dass das Aufklären der Wähler über negative Aspekte des Charakters, der Vergangenheit des gegnerischen Kandidaten oder der Partei ein positiver Teil des politischen Wettbewerbs ist. Die stets im Raum stehende Gefahr des Bumerangeffekts schützt die Demokratie zudem vor illegitimen Wahlkampfmethoden.
Mächtige Kampagnen-Zentralen
Die Rahmenbedingungen für den US-Präsidentschaftswahlkampf und für Negative Campaigning haben sich seit einem Urteil des Obersten Gerichtshofs vom Januar 2010 verändert: Bisher war die Höhe der Spenden an die Kandidaten und ihre Kampagnen limitiert. Diese Limitierung wurde nun für die PACs aufgehoben. Nun können Gewerkschaften, NGOs, Wirtschaftsverbände, aber auch Einzelpersonen unbegrenzt an PACs spenden, wodurch sogenannte Super-PACs entstanden. Jeder Kandidat verfügt über die Unterstützung einer oder mehrerer dieser der Kampagne nahestehenden, jedoch formell unabhängigen Unterstützerorganisationen. Die PACs, mit wohlklingenden Namen wie „Red, White and Blue“ (Santorum) oder „Winning our Future“ (Gingrich) sammeln Geld zur Unterstützung ihres Kandidaten. Eingesetzt werden die Mittel sowohl, um positive Botschaften über den eigenen Kandidaten zu verbreiten, als auch für negative Botschaften über die Mitbewerber. Sie bedienen alle Medien von der klassischen Zeitung über das Radio und Fernsehen bis hin zu Blogs, Videos im Internet und Handy-Apps.
Ein Meister der Effizienz dieser Wahlkampftechnik ist Mitt Romney – beziehungsweise der über rund 30 Millionen Dollar verfügende PAC „Restore our Future“. Romney hat es immer wieder geschafft, potenzielle Gegenkandidaten, die als Favoriten in einem Bundesstaat gute Chancen auf den Vorwahlsieg hatten, erfolgreich anzugreifen und aus der Pole-Position zu verdrängen. Dies hat Newt Gingrich in Iowa und Florida schmerzlich zu spüren bekommen und betrifft derzeit auch den neuen Shootingstar, Rick Santorum. Doch die beiden betroffenen Kandidaten verstehen das Handwerk der Negativbotschaften ebenso. So degradiert Newt Gingrich in einem Video Mitt Romney zu einem egoistischen Geschäftsmann, der mit seiner Firma Bain Capital Millionen verdient, Tausende von Arbeitern in die Arbeitslosigkeit geschickt hat und prozentual weniger Steuern zahlt als der Durchschnittsamerikaner. Rick Santorum wiederum wehrt sich gegen Romneys Angriffe mit dem einfachen Hinweis, dass dieser eine millionenschwere Schmutzkampagne gegen ihn führe, obwohl er als moralisch unbelasteter Kandidat die Unterstützung der Bürger hinter sich habe.
Für den Wähler bedeuten diese Attacken vor allem eins: einen tiefen Einblick in die Historie der Kandidaten, die gezwungen werden, neben ihrer Steuererklärung und ihren Einkünften auch ihre politische und private Vergangenheit offen darzulegen. Was in Europa oft den Eindruck einer Schmutzkampagne entstehen lässt, wird in den USA als Methode verstanden, alle relevanten und potenziell gefährlichen Details in Erfahrung zu bringen. Unvergessen bleiben daher auch die Attacken auf Barack Obama seitens seines späteren Vizekandidaten Joe Biden und seiner heutigen Außenministerin Hillary Clinton sowie seines Amtsvorgängers Bill Clinton. Geschadet hat es ihm nicht. Letztlich ist er sogar gestärkt in die entscheidende Wahlkampfphase gegangen.
Diesen Screeningeffekt erhoffen sich derzeit auch die Republikaner. Angesichts der zeitlichen Länge und Intensität der Auseinandersetzung sowie der bisher noch ungeeinten Partei mit vier potenziellen Kandidaten scheint dieser positive Effekt negativer Kampagnenführung jedoch mehr Wunsch als Realität zu sein.
Deutsche verteufeln Negative Campaigning
Und Deutschland? Sicher, Deutschland ist anders. Die Bundesrepublik hat ein anderes politisches System, ein anderes Mediensystem und vor allem eine andere politische Kultur als die USA. Doch gibt es politische Angriffe auch hierzulande. Dabei setzen die Akteure bislang nicht so sehr auf Spots, obwohl sich das im Zeitalter des Internets zu ändern scheint, sondern eher auf Plakate und Anzeigen in Zeitungen. Natürlich setzen sie auch auf Attacken in der Königsdisziplin der politischen Kommunikation, der Rede.
Viele Journalisten und Politiker verteufeln das Negative Campaigning. Es sei etwas Neues, etwas, das aus den USA komme und nicht zur politischen Kultur in Deutschland passe. Dies zu widerlegen, fällt nicht schwer – gibt es doch genügend Beispiele aus allen Wahlkämpfen der Bundesrepublik, bei denen der Gegner hart angegriffen wird. Ein Dauerbrenner aus dem bürgerlichen Lager bleibt die Warnung vor dem Kommunismus. Dies beginnt in den ersten Wahlkämpfen mit Slogans wie „Wo Ollenhauer pflügt, sät Moskau“ über die 1970er mit „Freiheit statt Sozialismus“ bis hin zu den „Roten Socken“ der 1990er Jahre. Auch das linke Lager war wenig zimperlich. So tauchte auf Plakaten der „Atombombenkanzler“ Adenauer auf oder die einfache Losung „Wer nicht wählt, wählt Strauß“. Persönlich wurde dann Gerhard Schröder mit seinen Angriffen auf den „Professor aus Heidelberg“. Die Beispiele zeigen deutlich: Erstens gehören Negativkampagnen seit Beginn der Bundesrepublik zum Wahlkampfrepertoire der Parteien, zweitens ist Angriffswahlkampf in Deutschland ganz anders als in den USA.
Mit Vorsicht zu genießen sind deshalb die in Deutschland geführten Diskussionen über die Amerikanisierung der Wahlkampagnen und die Legitimität des Angriffswahlkampfs. Angriffswahlkampf ist weder neu noch amerikanisch, und der Angriff ist nur dann nicht legitim, wenn Falsches behauptet oder wenn maßlos übertrieben wird. Im Grunde all das, was auch bei positiven Botschaften nicht legitim wäre und zu einem Bumerang wird. Ansonsten zählt in Deutschland, was auch in den USA gilt: „Attacking bad candidates for good reasons is public service“ – schlechte Kandidaten aus guten Gründen anzugreifen, ist ein Dienst an der Öffentlichkeit.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Hier lang – Wege in politische Berufe. Das Heft können Sie hier bestellen.