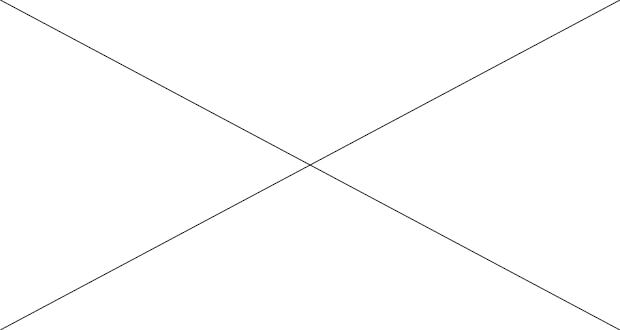p&k: Herr Sørensen, vor fünf Jahren hat die EU-Kommission eine neue Kommunikationsstrategie in Angriff genommen. Sie wollte bürgernäher werden. Ist dieses Konzept aufgegangen?
Claus Sørensen: Der Grundgedanke war, dass die EU-Kommissare nicht nur mit Ministern und Regierungschefs reden. Sie sollten auch mal ihr Büro verlassen, das richtige Leben spüren und beispielsweise Universitäten besuchen oder in eine Gemeinde gehen. Aber das in die Tat umzusetzen ist gar nicht so leicht, denn in Europa leben 500 Millionen Menschen, und kein Kommissar kann all deren Hände schütteln. Aber es ist ein wichtiges Zeichen, das die Kommission mit dem bürgernahen Ansatz setzt. Die Politiker und auch die Kommissare müssen mit den Bürgern in Europa einen echten Dialog führen.
Ist das denn gelungen?
Es ist schwer, so etwas empirisch zu messen und statistisch zu erfassen. Es ist uns in jedem Fall gelungen, dass die Kommissare stärker in direkten Kontakt mit den Menschen treten. Die Zahl dieser Kontakte von Kommissaren mit den Bürgern ist um 400 Prozent gestiegen. Sie reisen nicht häufiger als früher, aber sie treffen bei ihren Reisen jetzt mehr Bürger und weniger Politiker. Auch im Internet versuchen wir, bürgernah zu sein. Wir haben mit EU-Tube einen eigenen Kanal auf der Video-Plattform Youtube. Das ist eine tolle Sache, denn dort können wir zeigen, was die Ziele der EU sind und was sie mit ihren Entscheidungen konkret im Alltag der Leute bewirkt.
Der Erfolg solcher Aktionen lässt sich nur schwer messen, doch gibt es Indikatoren wie die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, die erneut gesunken ist. Ist Ihre Kommunikationsstrategie womöglich doch nicht so erfolgreich?
Natürlich lässt sich immer etwas verbessern, das ist klar. Hinsichtlich der Wahlbeteiligung gab es sehr unterschiedliche Resultate in den Mitgliedstaaten. Man muss differenzieren. In den neuen Mitgliedstaaten war sie nach dem Beitritt 2004 zunächst sehr hoch, weitaus höher als bei der diesjährigen Wahl zum EU-Parlament. Aber bezogen auf alle Mitgliedsstaaten gab es diesmal keinen signifikanten Einschnitt. Ja, die Wahlbeteiligung ist minimal gesunken, doch ob das nun an unserer Kommunikationspolitik lag, halte ich für fraglich. Ich kann nur sagen: Wir haben zumindest alles versucht, die Menschen zu erreichen und bei ihnen für die europäische Idee zu werben.
War die niedrige Wahlbeteiligung für Sie persönlich eine Enttäuschung?
Natürlich war es eine Enttäuschung, dass nur 43 Prozent der stimmberechtigten Bürger zur Wahl gingen. Mein persönliches Ziel war, dass die Kurve der Wahlbeteiligung wieder nach oben zeigt. Wenigstens haben wir – im Vergleich zum Erdrutsch 2004 – im Zusammenspiel aller Akteure eine Stabilisierung erreicht. Aber natürlich müssen wir besser werden, und das schaffen wir nur mit bürgernahen Konzepten. Diese zu entwickeln, ist eigentlich nicht so schwer, wie man an der EU-Roaming-Verordnung zur Senkung der Mobilfunktarife gesehen hat. Dieses Projekt wurde von uns gut kommuniziert. Den Beschluss zur Abschaffung der herkömmlichen Glühbirne haben wir hingegen nicht so gut erklärt. Wir konnten nicht verhindern, dass viele Fehlinformationen verbreitet wurden. Darauf hätten wir viel schneller reagieren müssen, denn immerhin greifen wir in die Traditionen und den Alltag von vielen Millionen Menschen ein.
Das zweite irische Referendum über den Lissabonner Vertrag war für die weitere Entwicklung der EU möglicherweise entscheidend. Sind Sie vor der Abstimmung oft nach Irland geflogen, um mit Medien und Meinungsmachern zu sprechen?
Wir hatten in diesem Fall keine eigens auf die Iren fokussierte Medienstrategie. Es war die gleiche Strategie wie überall: Information, Information, Information. Keine aufgeblasene Kampagne, aber besser zuhören. Und richtigstellen, wenn Mythen über Europa erzählt wurden.
Waren die Iren vor dem ersten Referendum nicht hinreichend über den Vertrag informiert?
Ja, ich glaube, dass ein Informationsmangel bestand. Das konnten wir auch anhand von Umfrageergebnissen durch das Eurobarometer sehen. Die Iren sagen selbst, dass sie beim ersten Mal nicht gut informiert waren.
War das ein Versäumnis der dortigen Regierung?
Man kann immer kritisieren, dass die Regierungen nicht genug tun würden. Aber auch eine intensive Kampagne kann nicht ausgleichen, dass regelmäßige Informationen über einen langen Zeitraum fehlten. Genauso falsch wäre es jedoch, pauschal zu behaupten: „Das Elend kommt aus Brüssel.“ Wir hatten kein spezifisch irisches Problem, vielmehr verstehen die Regierungen langsam, dass eine ständige Debatte und Auseinandersetzung über Europa wichtig ist. Und sie verstehen auch, dass das Schwarze-Peter-Spiel nicht hilfreich ist, nach dem Motto „das Böse kommt aus Brüssel, die Wunder aber aus unserer Hauptstadt“. Alle tragen einen Teil der Verantwortung für Europa, die Regierungen, die Politiker und die EU.
Es heißt, beim zweiten Referendum in Irland habe auch die Wirtschafts- und Finanzkrise eine Rolle gespielt. Hat die Krise sich womöglich positiv auf die Stimmung gegenüber der EU ausgewirkt?
Ich glaube, dass die Krise einen gewissen Einfluss auf das irische Referendum hatte. Gegenüber dem Votum im Vorjahr gab es so etwas wie ein neues Bewusstsein. Die Menschen erinnerten sich an die Solidarität in der EU und die massiven Strukturhilfen, mit deren Hilfe das Land einen gewaltigen Aufschwung genommen hatte. Außerdem hatten sie das abschreckende Beispiel Islands vor Augen, ein Land außerhalb der EU und ohne Euro, das wegen der Finanzkrise beinahe kollabiert wäre.
Es gibt einige Länder wie Großbritannien, die traditionell europaskeptisch sind. Fokussiert die Kommission ihre Kommunikationsarbeit auf solche „Sorgenkinder“?
Natürlich ist es unsere Aufgabe, auch die Skeptiker und Kritiker anzusprechen. In Großbritannien engagieren wir uns seit zwei, drei Jahren besonders stark. Wir haben über das Land verteilt Außenstellen unseres Informationsnetzwerkes Europe Direct aufgebaut. Unsere Mitarbeiter sprechen zum Beispiel in Manchester oder Bristol mit den Menschen über die Strukturfonds oder Sozialmaßnahmen der EU und sind dann oft erstaunt, wie interessiert die Briten sich zeigen. Sonst hört man ja nur die lauten Töne der euroskeptischen Elite in London. Natürlich hat Großbritannien eine sehr starke Bindung zu den Vereinigten Staaten, und schließlich gibt es da auch noch das Commonwealth, das für die Briten eine große Bedeutung hat. Aber ich sehe hierin keinen Widerspruch. Der Atlantik ist Teil unserer Identität.
In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Parlament bei europäischen Entscheidungen stärker eingebunden werden muss. Hat sich der deutsche Gesetzgeber bislang nicht genug mit europäischen Fragen befasst?
Ich bin dem Karlsruher Gericht wirklich dankbar, was diesen Punkt betrifft. Sei es der Deutsche Bundestag, die französische Assemblée Nationale, der schwedische Riksdag oder das dänische Folketing: Sie alle müssen sich intensiver mit Europa, den EU-Richtlinien und -Verordnungen befassen. Da ist es gut, dass der Lissabon-Vertrag zum Beispiel die Subsidiaritätskontrolle auf die lokale Ebene ausweitet. Als Folge davon müssen die Parlamentarier sich nun genau überlegen, ob bei bestimmten Entscheidungen die EU als Akteur zum Zuge kommen sollte oder ob es nicht besser wäre, wenn die betroffenen Länder, Regionen oder Kommunen für die Umsetzung sorgen würden.
Oft wird bemängelt, dass eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit, dass ein einheitlicher Raum für europaweite Diskussionen fehlt. Sehen Sie das auch so?
Eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit wird kommen. Das liegt an paneuropäischen Themen, von Ryanair bis zu Mobilfunkgebühren, und an globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel. Transportiert werden solche Themen oft über das Internet. Die europäische Öffentlichkeit ist noch nicht so stark wie die nationalen Öffentlichkeiten, und die vielen verschiedenen Sprachen in Europa machen das Ganze auch nicht leichter. Aber das wird sich ändern, auch dank technischer Neuerungen wie Twitter oder Facebook.
Wenn das Jahr 2009 vorbei und der Lissabon-Vertrag dann möglicherweise komplett ratifiziert ist: Werden Sie dann feiern?
Wenn es denn soweit ist, wird es für mich eine große Erleichterung sein. Wir haben zu viel über Institutionen gesprochen und zu wenig über die brennenden politischen Fragen. Wir müssen uns endlich und mit doppeltem Elan den konkreten Herausforderungen und Problemen zuwenden. Vielleicht werde ich statt Sekt nur Selters trinken, am Ende dieses sehr schwierigen Prozesses. Jetzt heißt es „an die Arbeit“: Es warten die Themen Wachstum, Beschäftigung, Innovation, Klimawandel und Milchquoten. Ich freue mich darauf!
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Politiker – wie sie leben und arbeiten. Das Heft können Sie hier bestellen.